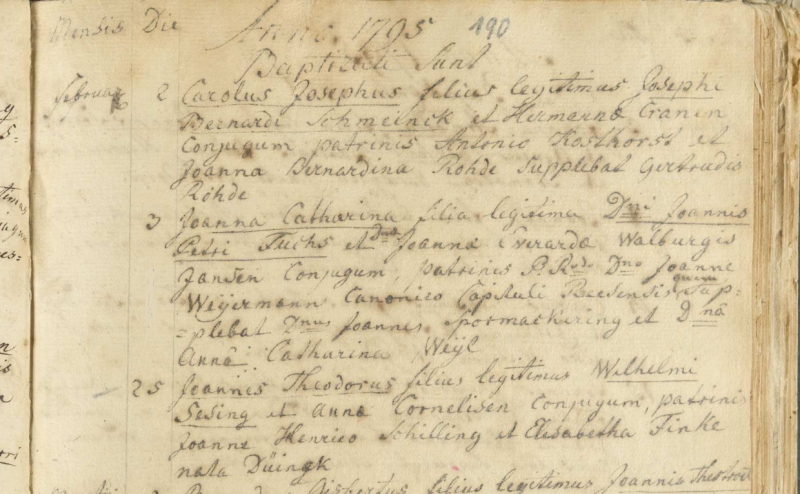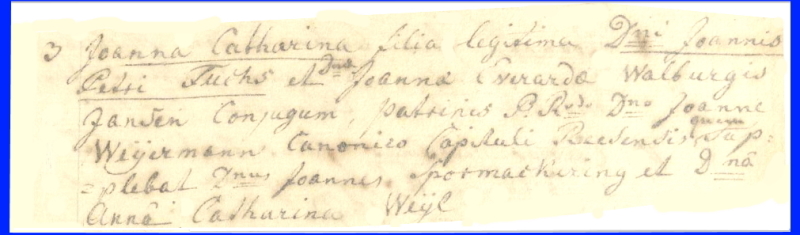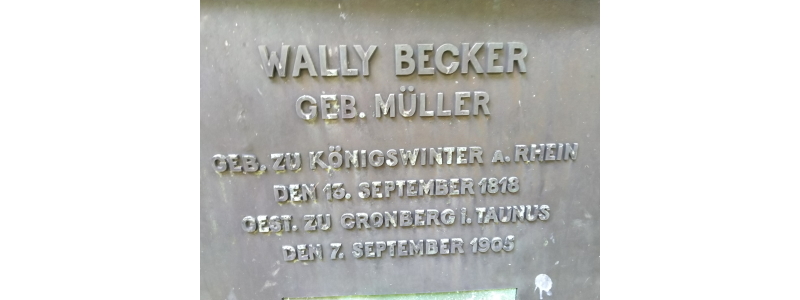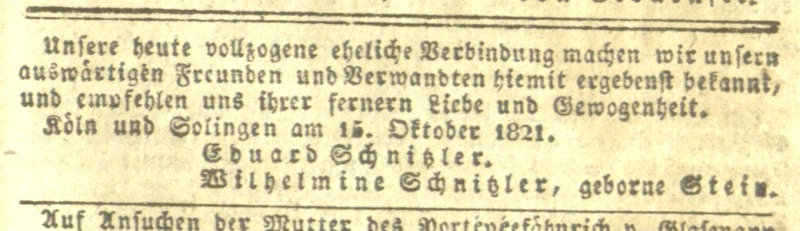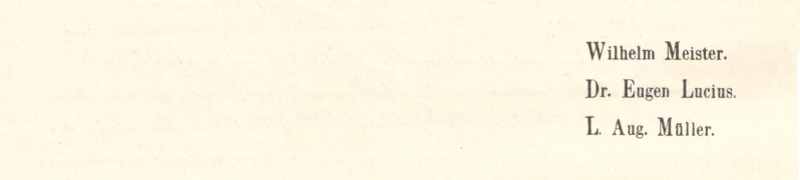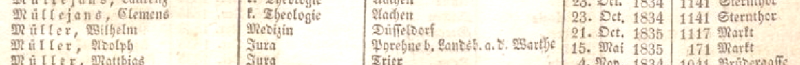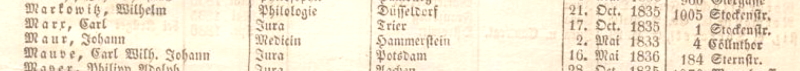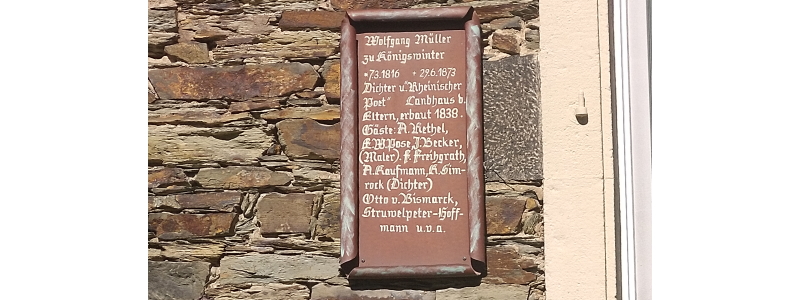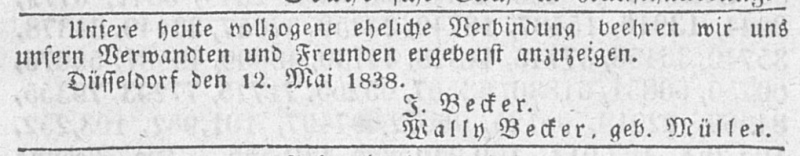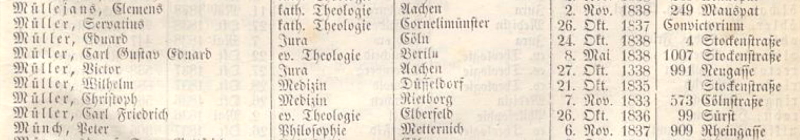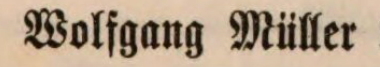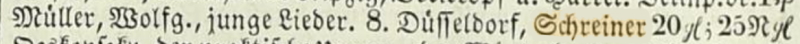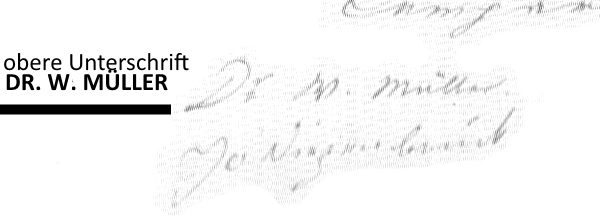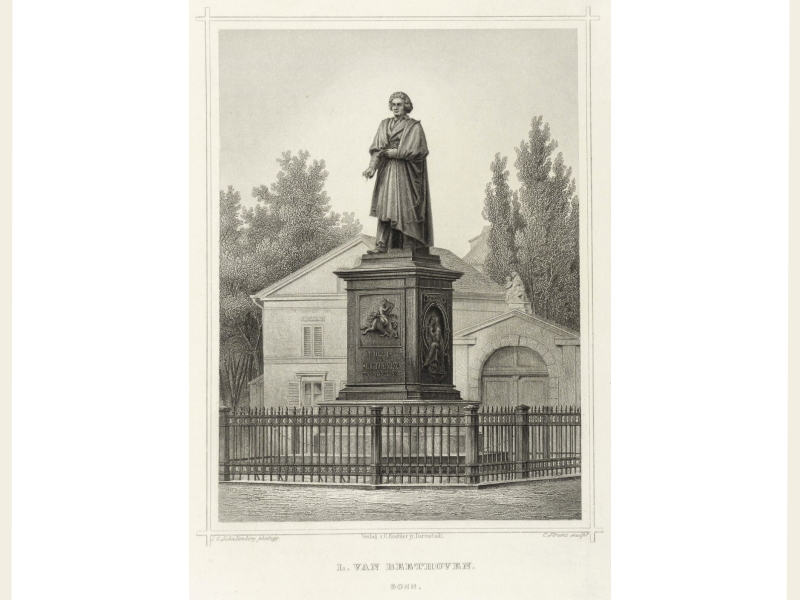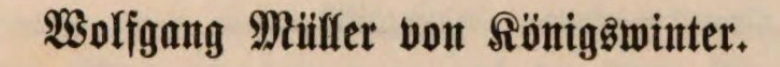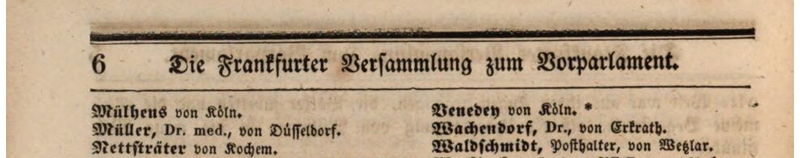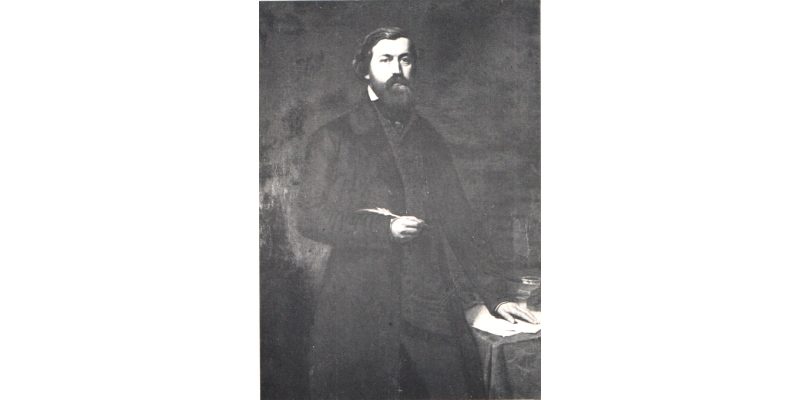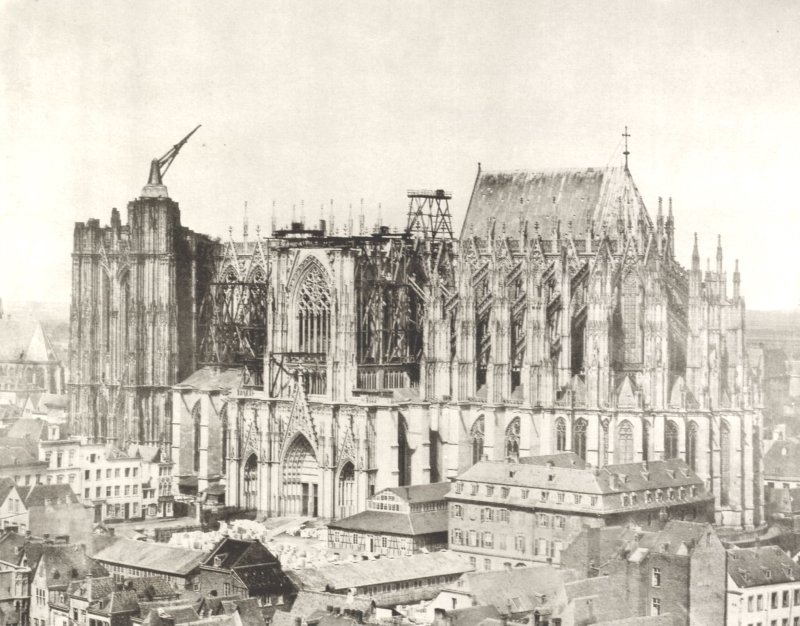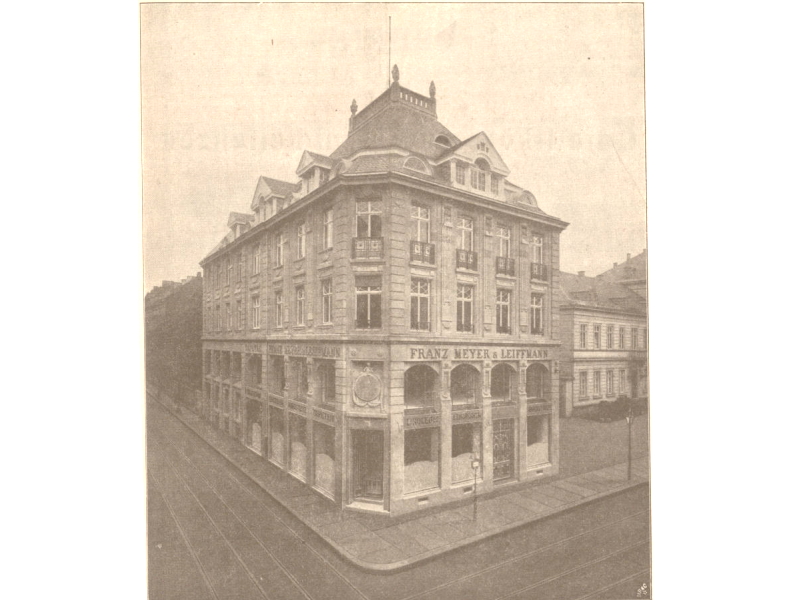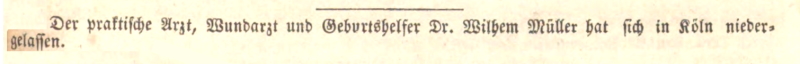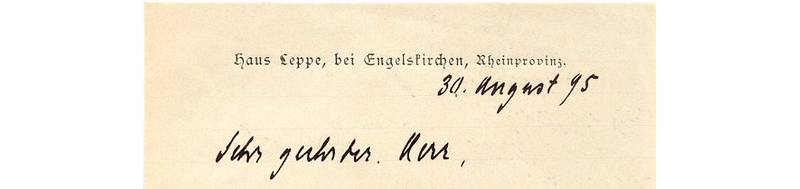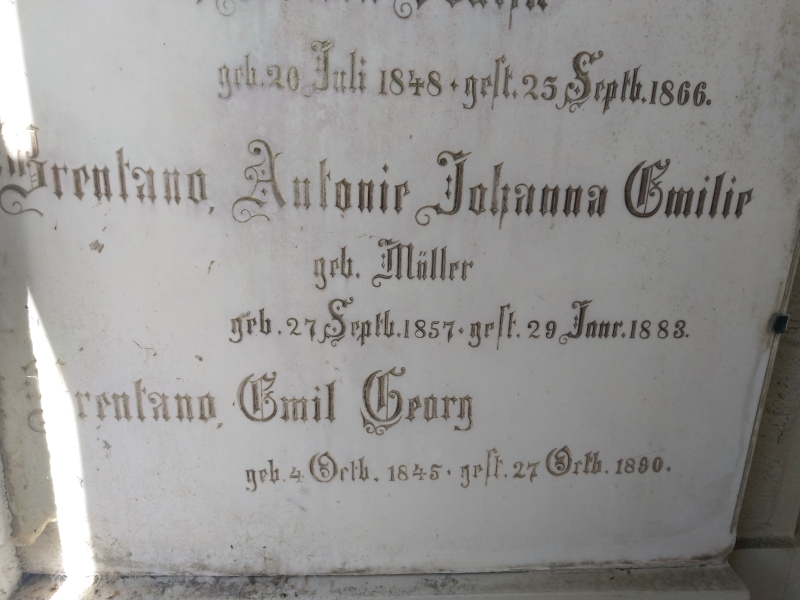Wolfgang
Müller von Königswinter ||| hier die tabellarische Biografie
||| Kontakt info A:E:T:T klausjans.de
|_ __| |_
__| |_ __| |_ __| |___| |__ __|
|_ __| |_ __|
__|
|_ __| |_ __|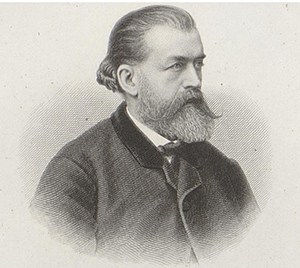
BIOGRAPHIE Biografie,
TABELLARISCH als
ZEITLEISTE,
zu und für
Wolfgang Müller von Königswinter
| * 5.3.1816 | + 29.6.1873 | W. M. v. K.








Geboren
als Peter Wilhelm
Carl Müller, der (Künstler-)Vorname Wolfgang wurde erst um
1840/1841 angenommen.
Als
Arzt blieb er weiterhin Wilhelm/Wilh./W. Müller.
So, als
Wolfgang Müller,
publizierte er endlich
im (zweiten) Rheinischen Jahrbuch für Kunst und Poesie
1841.
Und
so, als Wolfgang, veröffentlichte er auch sein erstes eigenes Buch,
"Junge
Lieder".
Letzteres
erschien vermutlich noch Ende März 1841, spätestens aber
April 1841.
--
ACHTUNG: WIKIPEDIA gab früher
fälschlich den 15.3.1816
an -- aber: seit dem 14.2.2023 findet sich dort das richtige Datum
für die Geburt: 5.3.1816.
--
ACHTUNG: Die NDB hat das falsche Geburtsdatum in der gedruckten
Version: 15.3.1816: Siehe 1997:
Hütt, Wolfgang, „Müller, Wolfgang“, in:
Neue Deutsche Biographie
18 (1997), S. 486–487. Die
Online-Version hat aber nun das richtige Geburtsdatum: 5.3.1816.
--
ACHTUNG: Auch die ADB hat das falsche
Geburtsdatum 15.3.1816: Siehe
"Allgemeine deutsche Biographie", Bd.:
22, Mirus – v.
Münchhausen, Leipzig, 1885, S. 698–701, der Müller-Artikel
ist von Franz Brümmer.
TEXT DER GEBURTSURKUNDE, zitiert nach Luchtenberg, Paul
(1959): Wolfgang Müller von
Königswinter. 2 Bände. Köln: Verlag Der Löwe, Dr.
Hans Reykers (Veröffentlichungen des Kölnischen
Geschichtsvereins e. V., 21). Hier: Band 1, Seite 378, da beginnen die
Anmerkungen.
"Im Jahr eintausend
achthundert sechzehn am siebenten März, Nachmittags um 5 Uhr,
erschien vor
mir Clemens August Schäfer, Bürgermeister der Stadtgemeinde
Königswinter, der Herr Johann Georg Müller, Arzt, wohnhaft in
Königswinter mit
der Anzeige, dass am Dienstag, den
fünften des Monats Merz, des
Nachts um
1 Uhr ihm seine Gattin Johanna Catharina Fuchs ein Kind
männlichen
Geschlechts geboren, dem er die Vornamen Peter Wilhelm Carl beygelegt
habe.
Zeugen bey dieser Handlung waren: Heinrich von Zastrow neun und
zwanzig jährigen Alters, Steuercontroleur, wohnhaft in
Königswinter und
Heinrich Breitenstein, neun und zwanzig Jahre alt, Gerichtsschreiber,
wohnhaft in Königswinter, gez.: Johann Georg Müller, Heinrich
von Zastrow,
Heinrich Breitenstein. Nach Vorlesung unterschrieben sämtliche
mir." gez.:
Schäfer.
TEXT DER TAUFURKUNDE, zitiert nach Luchtenberg, Paul
(1959): Wolfgang Müller von
Königswinter. 2 Bände. Köln: Verlag Der Löwe, Dr.
Hans Reykers (Veröffentlichungen des Kölnischen
Geschichtsvereins e. V., 21). Hier: Band 1, Seite 378, da beginnen die
Anmerkungen. -- Hinweis: Die Eltern hatten in Bodendorf am 30.4.1815
geheiratet, die W. M. v. K.-Mutter Johanna Katharina Fuchs stammte
daher, wurde allerdings dort nicht geboren.
"Aedibus in propriis tinctus jubente
pericolo. 5. Martii 1816
Petrus Wilhelmus
Carolus
Parentes: D. J.
Georgius Müller Medicinae Doctor et huius Cantonis Physicus et D.
Joanna Catharina Fuchs, hujates, copulati ao 1815 30. april in
Bodendorf a/Ahram. Patrini: D. Wilhelm Adrianus Fuchs Negotiator
Rotterodamensis, cuius vices egit D. Franziscus Carolus Werne
Pacisjudex hujas et
Dna. Joanna Walburgis Everhardina Jansen, Vidua Fuchs ex Bodendorf
a. A."
--
Diese Biografie als Zeitleiste ist ein Work in Progress -- IDEE DABEI:
Eher genau sein,
immer wieder prüfen und
abklopfen, Urquellen angeben, wann immer möglich,
damit man bezogen auf Daten und Fakten eine
ordentliche Grund-Quelle im Internet
für allerlei Zwecke hat. ||| Paul
Luchtenbergs
so bedeutsame 2-Band-Ausgabe von 1959 ist
dafür zu umfangreich, zudem konnte er damals die
Fakten nicht zusätzlich
per Internet-Funden untermauern. Denn: Es gab damals noch kein
Internet. ||| Etliche Fakten hier sind neu.
:::
DIESE KURZE, ABER DANN DOCH EHER AUSFÜHRLICHE
TABELLARISCHE BIOGRAFIE HAT AUCH EINEN
BEZUG ZU DIESEM BUCH, Neuerscheinung Dez. 2022:
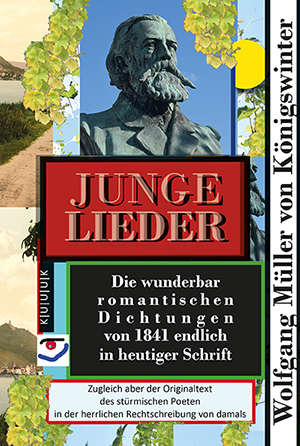
Wolfgang Müller von Königswinter
Junge Lieder
Die wunderbar romantischen Dichtungen von 1841 endlich in heutiger
Schrift
Zugleich aber der Originaltext des
stürmischen Poeten in der herrlichen Rechtschreibung von damals
DIREKTLINK ZU Wolfgang
Müller von
Königswinter: JUNGE LIEDER (das Buch
erschien
im Dezember 2022)
Schauen Sie auch auf der Homepage-Seite Komponistinnen/en-Liste dazu für Vertonungen zu den
Gedichten aus "Junge Lieder".








BIOGRAPHIE
Biografie, TABELLARISCH
als ZEITLEISTE,
zu und für
von
Wolfgang Müller von Königswinter (kurz als W. M. v. K.)
-- WORK IN PROGESS --
 ~
Wolfgang
Müller von Königswinter (1816-1873) | Bildnis entstand
vermutlich circa 1861. Quelle
hier offenbar Gemäldesammlung Düsseldorf. ||| Von 1861
vermutlich, so K. J., und vermutlich, so K. J., nach einem Holzschnitt
von Alfred
Neumann. (Geboren am 5. Juni 1825 in Leipzig, gestorben am 20. November
1884 in Leipzig.) | BILD-QUELLE für diese Düsseldorfer
Abbildung: Wikimedia Commons
Direkt-Link | Das Bild,
so K.
J., ist nämlich
analog, quasi identisch also,
zu einem weiteren (G 7710/a) im Kölnischen Stadtmuseum.
~
Wolfgang
Müller von Königswinter (1816-1873) | Bildnis entstand
vermutlich circa 1861. Quelle
hier offenbar Gemäldesammlung Düsseldorf. ||| Von 1861
vermutlich, so K. J., und vermutlich, so K. J., nach einem Holzschnitt
von Alfred
Neumann. (Geboren am 5. Juni 1825 in Leipzig, gestorben am 20. November
1884 in Leipzig.) | BILD-QUELLE für diese Düsseldorfer
Abbildung: Wikimedia Commons
Direkt-Link | Das Bild,
so K.
J., ist nämlich
analog, quasi identisch also,
zu einem weiteren (G 7710/a) im Kölnischen Stadtmuseum.
Copyright
für diese Liste und Datensammlung ©
Klaus
Jans ab Nov 2022 ff.
NOCH VOR der Geburt von W. M. v.
K.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER
Was ringsum
passierte
|
| 1780 ||| 24.9.1780 |
* Geburt des Vaters von W. M. v. K. =
Johann
Georg Müller am * 24. September 1780 in Mülheim am
Rhein [Quelle
B, Bd. 1, S. 379]. (Dieses Mülheim wird jedoch erst 1914 zu
Köln eingemeindet werden.) [X]
|
+ Tod des W. M. v. K.-Vaters dann
am 22. September 1842 in
Düsseldorf. (Siehe weiter unten auf dieser Web-Page. Auch Text der
Traueranzeige aus der Zeitung.) [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1792 ||| 15.10.1792 |
* Geburt des (später dann)
Schwiegervaters von W. M. v. K.: Karl Eduard Schnitzler (*
15.10.1792)
in Gräfrath, der Ort ist seit 1.8.1929 verschmolzen mit/zu
Solingen. Er war ein deutscher Bankier und Gründer der
gleichnamigen Kölner Bankiers-Dynastie. (Folgt man der
Hochzeitsanzeige von 1821 war sein Rufname: Eduard, siehe zur Anzeige
weiter unten bei 15.10.1821 auf dieser Web-Page.) [X]
Eduard Schnitzler heiratete  am 15. Oktober 1821 Wilhelmine Stein (* 7.
3.1800 in
Köln | + 25.12.1865 Köln), die Tochter des Johann Heinrich
Stein, Begründer des (dann allerdings erst später dazu
gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der Katharina Maria Peill.
am 15. Oktober 1821 Wilhelmine Stein (* 7.
3.1800 in
Köln | + 25.12.1865 Köln), die Tochter des Johann Heinrich
Stein, Begründer des (dann allerdings erst später dazu
gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der Katharina Maria Peill.
|
Tod von Karl Eduard Schnitzler am
+ 6.2.1864 in Köln. Siehe dazu weiter unten auf dieser Web-Page.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1795 ||| 3.2.1795
|
* Geburt der Mutter von
W. M. v. K. am 3.2.1795 in Anholt. Sie heißt Johanna/Joanna Catharina/Katharina Fuchs.
Sie
stirbt am + 3.8.1876
in Remagen mit 81
Jahren.
[Quelle B, Bd. 1, S. 379 u. Stammbaum Fuchs im Heimatarchiv Bad
Bodendorf.]
K. J. entdeckte am 16.4.2023 die Taufurkunde von eben dieser
Johanna/Joanna Fuchs, der Mutter des W. M. v. K.:
Demnach wurde sie am 3.2.1795 in Sankt Pankratius in Anholt
(Anholt gehört heute zu Isselburg. Kreis Borken, Münsterland)
getauft. Wurde sie am gleichen Tag wie die Geburt auch noch getauft?
Oder ist das bekannte Geburtsdatum am Ende (nur) das Taufdatum?
[Quelle: Münster, rk.
Bistum Anholt, St. Pankratius Taufen | KB004_1 ||| Taufen von 1. Januar
1754
Datum bis 31. Dezember 1808.] [X]
Der Vater taucht hier als "Joannis Petri Fuchs" auf, die Mutter als
"Joanna Everarda Walburgis Jansen".
|
Sie heißt später Müller.
Ihr Ehemann wird  am
30.4.1815 Johann Georg Müller. ⚭ Heirat in
Bodendorf an der Ahr. am
30.4.1815 Johann Georg Müller. ⚭ Heirat in
Bodendorf an der Ahr.
Ihre Eltern sind [laut Stammbaum der Familie Fuchs, übermittelt
vom Heimatarchiv Bad Bodendorf, am 3.4.2023 durch Archivleiter Herrn
Josef Erhardt, herzlichen Dank]:
1 MUTTER) Johanna
Walburga Everharda Fuchs, geborene Jansen, * geboren
am 20.2.1764 in Rees | + gestorben am 9.2.1822 in Bodendorf
2 VATER) Johann
Peter Fuchs, * geboren am 23.1.1756 in Köln | +
gestorben am 19.12.1813 in Bodendorf
Beide heiraten  am
27.8.1780 in Köln. am
27.8.1780 in Köln.
|
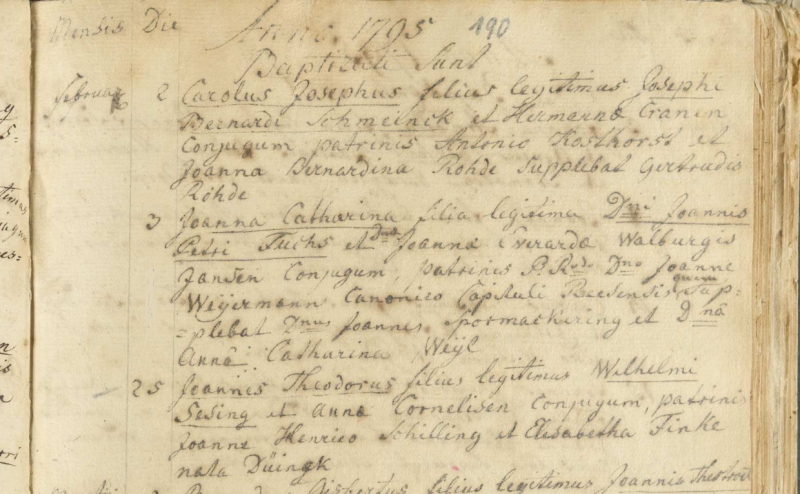
3.2.1795
= Taufe der Joanna Catharina Fuchs, man sehe bei der Zahl 3 den
lateinischen Text. (Später findet man den Namen moderner dann
meist als Johanna mit h: Johanna Catharina Fuchs.) In der Kirche St.
Pankratius in Anholt im Münsterland war diese Taufe.
Joanna/Johanna wird (ab 1815 verheiratet als Johanna Catharina
Müller, geb. Fuchs) im Jahr 1816 dann die Mutter von W. M. v. K.
werden.
||| Die
Taufe von Joanna/Johanna Catharina fand nach dem Auszug aus dem
Kirchenbuch am 3.2.1795 statt. ((Siehe auch weiter oben (↑) den
tabellarischen Eintrag auf dieser Homepage hier.)) [X] Das zweite
Schrift-Bild hier unten ist derselbe Kirchenbuch-Eintrag, aber
extrahiert und etwas größer und zudem aufgehellt. [X]
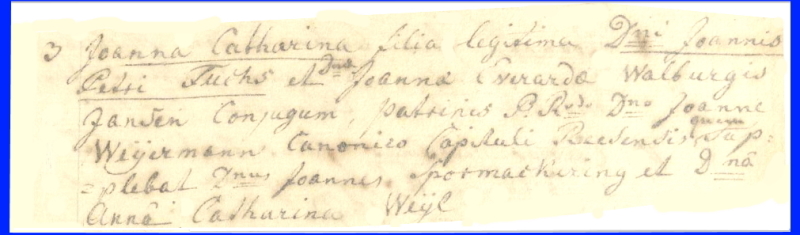
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1800 ||| 7.3.1800 |
* Geburt der später dann
Schwiegermutter von W. M. v. K.: Wilhelmine
Stein (* 7. 3.1800 in Köln | + 25.12.1865 Köln), die
Tochter des Johann Heinrich Stein, Begründer des (dann allerdings
erst später dazu gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der
Katharina Maria Peill. |
Wilhelmine
Stein heißt später nach der Hochzeit Wilhelmine Schnitzler. (Bzw.
Wilhelmine Schnitzler-Stein, darauf deutet zumindest eine Widmung von
W. M. v. K.
in seiner Publikation "Vier Burgen", 1862, hin. [X])
Denn: Ihr Ehemann  wird am 15.10.1821 Karl Eduard
Schnitzler
(15.10.1792–6.2.1864).
wird am 15.10.1821 Karl Eduard
Schnitzler
(15.10.1792–6.2.1864).
Kinder der beiden sind u. a.
-Emilie (11.7.1822–2.6.1877), 1847 die Ehefrau ⚭ des W. M.
v. K.
-Eduard Julius (3.8.1823–16.9.1900)
-Robert (21.2.1825–27.9.1897)
-Ernst Otto (11.5.1838–20.11.1842)
[Quellen B und C und F und J]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1802 ||| 28.8.1802
|
* Geburt des späteren Freundes Karl
Simrock
|
Karl
Joseph Simrock (* 28. August 1802 in Bonn | + 18. Juli 1876 Bonn)
Dichter, Philologe, Professor. Und ein Freund von W. M. v. K.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1802 |
Die Familie Fuchs, hier die
Großeltern von W. M. v. K., noch genauer: der Großvater ...
er gelangt in den Besitz des "Landskroner Zehnthofes" in Bodendorf.
Ersteigerer war nämlich Jean Peter Fuchs (= Johann Peter Fuchs)
aus Bonn. W. M. v. K. wird diesen Opa allerdings nie kennenlernen.
"Fuchs ersteigerte 1802 von Freiherr
vom Stein den Landskroner Zehnthof
in Bodendorf (Hauptstraße 109, 111, 113). Das Haus
Hauptstraße 138 wurde später von Müller als
Feriendomizil (um 1835) erbaut. Dort ist der abgebildete Stein
aufgestellt, zwei weitere sind bekannt." Das steht in dem
Beitrag "Die
Landmessung von 1792 und andere Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr.
Karl August Seel, Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler 1992", ab Seite
55 findet sich der Gesamttext, konkret ist diese Information eine zu
dem
Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10.
|
Großvater mütterlicherseits
zu W. M. v. K. war Johann Peter Fuchs, * 23.1.1756 Köln | +
19.12.1813 Bodendorf.
[Angaben laut Quelle B, Bd. 1, S. 379] Die Franzosen sagten dann "Jean"
zu Johann, und so gelangte das Jean dann wohl auch in etliche Urkunden.
Johann Georg Müller, Arzt in Düsseldorf, Vater von W. M. v.
K., wird um 1835 (zusammen mit seiner Ehefrau, eine geborene Fuchs) in
Bodendorf neu bauen. Das neue Haus der Müller-Familie steht im
Übrigen heute noch.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
1809 ||| 7.12.1809 und 9.12.1809
|
Zur Promotion schrieb sich Johann Georg
Müller, der spätere Vater von W. M. v. K., am 7. Dezember
1809 an der Universität in Duisburg ein, zwei Tage später
(!!!) legte er dort bei Professor Daniel Erhard Günther die
Prüfung
mit einer 14-seitigen Arbeit "De vi naturae medicatrice" ab. (Deutsch
wäre es "Über die Heilkraft der Natur".)
(Man brauchte nun zur Ausübung des Arztberufes formelle Nachweise,
das war bis dahin nicht so. Deshalb der eilige Vorgang! Einschreibung
bis Dissertation 2 Tage! [X])
In dieser
Dissertation bezog er, Müller, hier der W. M. v. K.-Vater, sich
auf den Animisten und zugleich sehr naturheilenden Kräften
vertrauenden Georg Ernst Stahl, dessen Prinzipien er, Müller,
auch später noch sehr oft anwendete und befolgte.
Die Dissertation
widmete er, Johann Georg Müller, den
Mitgliedern des Düsseldorfer Medizinalkollegiums, darunter Johann
Gotthelf Leberecht Abel. ||| Möglicherweise hatte Johann Georg
Müller jedoch einen Teil seiner Ausbildung in Düsseldorf
absolviert. Dazu gibt es allerdings bislang keine Nach- und Beweise.
Auch in Köln wird er viel an Medizin erlernt haben. Zum Beispiel
am Bürgerspital. Außerdem waren Vorlesungen damals noch frei
für Jedermann. Es sind vieles aber nur Vermutungen. [Siehe
Quelle D, z. B. Seiten 1–6]
|
Quelle hier W, aber offenbar ist die
eine Ur-Quelle dazu das Buch Quelle D. [Siehe ganz unten auf der
Homepage die mit Buchstaben ausgewiesenen Quellen. ||| K. J. hat das
Buch
Quelle D, Herausgeberin Sabine Graumann, mittlerweile selber im
Stadtarchiv Bonn eingesehen.]
Es schrieb sich ein: "Georgius Müller / Honor. doct. med.
Candidatus / Aetas: 28 / Pater: Petrus Müller, Schneidermeister /
Mülheim am Rhein" [Quelle D, Seite 4]
Wir wissen also, dass der Vater von Johann Georg Müller und damit
der Großvater von W. M. v. K. ein Schneidermeister war. |||
Mülheim war damals noch nicht zu Köln eingemeindet. das
geschah erst 1914, also über 100 Jahre später.
|
1808/1809 ||| Am 21.
Dezember
1808 gründen Carl Friedrich Zelter
et al. die "Berliner Liedertafel" / "Zeltersche Liedertafel", den
ersten bürgerlichen Männerchor der deutschen Geschichte. Am
24. Januar 1809 fand die erste reguläre Sitzung statt. [Quelle:
Neue Berliner Musikzeitung 16 (1862), S. 60.]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1810 |
Müllers
Vater, der Arzt Johann Georg Müller, der anfangs offenbar
(nach der Promotion Duisburg) kurz in Euskirchen als Arzt arbeitete,
was wir z. B. aus dem Totenzettel wissen, + 22.9.1842 starb er, ist seit 1810 Kantonsarzt in
Königswinter. (Hinweis: K. J.: Wir müssen
berücksichtigen, dass es die französische Besetzung gab, und
in der Folge auch französische Verwaltungstrukturen, mit der
Zugehörigkeit zu Preußen ab 1815ff. wurde erneut dann alles
anders.)
Königswinter heute:
Hier die Rheinallee et al. Open-Street-Map-Direkt-Link,
Copyright © OSM-Mitwirkende.
[X]
|
[Quelle D, Seite 8. Urquelle dazu ist
offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer Kulturbesitz, also:
GStA PK, I. HA Rep, 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 59 vor.] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1810 ||| 8.2.1810
|
* Geburt des späteren W. M. v.
K.-Freundes Norbert Burgmüller
|
* Geburt von August
Joseph Norbert
Burgmüller (1810–1836), Jugendfreund von W. M. v. K.: *
8. Februar 1810 in Düsseldorf | + 7. Mai 1836 in Aachen.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1810 ||| 15.3.1810
|
* Geburt des späteren W. M. v.
K.-Schwagers Jacob Becker
|
* In Dittelsheim bei Worms |||| *
Geburt Jacob Becker (15.3.1810–22.12.1872), wurde
Maler, Freund von
Müller,
seit 1833 an der Düsseldorfer Kunstakademie, später, ab ⚭
1838,
auch Ehemann von Müllers Schwester Wally (alias
Walburga Caroline Müller). |||
Müller schreibt ein paar Seiten über Becker (Jakob Becker von
Worms) 1873 in der
Zeitschrift "Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft", 2.
Band 1873. Seite 1050 bis 1055.
|
1810 ||| Gründung einer
Männergesang(s)vereinigung durch Hans
Georg Nägeli (1773–1836) in Zürich in der Schweiz.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1810 ||| 17.6.1810 |
* Geburt des späteren Freundes Ferdinand Freiligrath
|
* Geburt von (Hermann) Ferdinand
Freiligrath, * 17. Juni 1810 in Detmold |
+ 18. März 1876 in
Cannstatt
|
1811 ||| 2. bis 4.11.1811, Napoleon in Düsseldorf
1813 ||| Niederlage Napoleons, Völkerschlacht Leipzig (16.
bis
19.10.1813)
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1813 ||| 19.12.1813 |
+ Tod von W. M. v. K.s Großvater
mütterlicherseits. Johann Peter Fuchs stirbt + am 19.12.1813 in
Bodendorf/Ahr. [Quelle B, Bd. 1, S. 379]
Der Dichter und Schriftsteller W. M. v. K. wird diesen (seinen) Opa
mütterlicherseits nie
kennenlernen, weil er erst * 5.3.1816 auf die Welt kommt.
|
Peter Johann Fuchs wurde am
* 23.1.1756 in Köln geboren.
[Quelle B, Bd. 1, S. 379] |
1814 Das Düsseldorfer Lyzeum (damals unter
Direktor Karl Wilhelm Kortüm) wird durch die preußische
Schulbehörde in das „Königliche Katholische Gymnasium“
umgewandelt. W. M. v. K. wird diese Schule ab 1827 (Er als
Neu-Düsseldorfer, anfangs ohne seine Eltern sogar in
Düsseldorf, Müller dort bei einem Oheim wohnend) besuchen.
Heinrich Heine war an dieser Schule auch, allerdings nur bis 1814.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1814 ||| November 1814 |
W. M.
v. K.s Vater, jener Arzt Johann Georg Müller, verfasst als Georg
Müller (zugleich als "Kantonsphysiker") bereits 1814 eine
"Raisonirende Topographie des Cantons Königswinter von Docktor
Georg Müller November 1814". ||| 13 Jahre später wird
er (und nach dem Wegzug von Königswinter, der wird 1820 sein) als
Johann Georg Müller auch für seinen neuen Wirkungsort
Bergheim wieder solch einen Bericht vorlegen:
"Der Kreis
Bergheim um 1827, Preußische Bestandsaufnahme des Landes und
seiner Bevölkerung". [Siehe Quelle D.]
Darin (zum Bericht zu Königswinter 1814) steht zu
Königswinter fast ganz am Anfang: "Das
Städchen zählt 228 Häuser und 1296 Seelen." (Seite 37,
siehe Buch-Angabe hier rechts in der Spalte.)
Hintergrund: Laut Dekret des Generalgouverneus des Gouvernements Berg
vom 16.4.1814 sollten in allen Kantonen des Großherzogstums
"Kantonsphysiker" ernannt werden, zuvor gab es "Kreisphysiker", aber
die politische Gliederung hatte sich "nach Napoleon" erneut
verändert. Zudem: In § 2 des Dekrets wurde so eine
"raisonirende" Darstellung des Cantons gefordert, bei Dienstantritt
zudem. Genauer: Darstellung aller Localitäts-Verhältnisse,
"welche mit dem Gesundheitswohl der Einwohner in dem Kanton in einem
nähern oder entferntern Bezug stehen". [X]
|
In (Johann) Georg Müllers
Paginierung (Handschrift!) von 1814 waren es 48 Seiten. Siehe in: Vom Amt Wolkenburg zum Canton
Königswinter zwischen dem Breitenbacher Graben und der
Siegmündung / von Winfried Biesing Topographie
des Cantons Königswinter von Docktor Georg Müller Physicus
des Cantons und pracktischem Arzte daselbst November 1814 / von Georg Müller.
Transkribiert von Manfred van Rey. [Gesamtwerk.] Hrsg. vom Heimatverein
Siebengebirge e.V., Königswinter, 1984. [Siehe auch ganz unten bei
den Angaben zu Quelle D.]
|

Das
kleine, überschaubare
Königswinter
(ja, mit dem berühmten Petersberg, wo die Queen E. oben im Hotel
mal nächtigen sollte) ungefähr zu Zeiten
von Johann Georg Müller, anfangs hieß er Kantonsarzt – und 2
oder 3 Jahre nach Geburt dessen Sohnes
Wilhelm (alias später dann W. M. v. K.) im Jahr 1816. –
Zwischen 1801 und
1814
wurden die Rheinlande auf persönlichen Befehl Napoleons unter dem
Kommando des Oberst Jean Joseph Tranchot topographisch aufgenommen
(kartiert). Nach dem Tod von Tranchot 1815 setzte Karl von
Müffling das Projekt für die preußische Regierung fort.
Die Bearbeitung wurde angeblich 1828 beendet. [W] [So liest man auch
bei der
Bezirksregierung Köln: 1801–1828, www.bezreg-koeln.nrw.de,
Maßstab angeblich 1:25.000] [An anderer Stelle im Netz findet man
aber auch den Maßstab 1:20.000, vielleicht gab es Karten in
unterschiedlichen Maßstäben bei diesem
Großprojekt.] ||| An anderer
Stelle heißt es zudem: "Kartenaufnahme der Rheinlande durch
Tranchot und
von Müffling (1803 - 1820)". Also nur bis 1820? Oder doch bis
1828? Oder die im heutigen Rheinland-Pfalz nur bis 1820, nur die?
Woanders aber noch bis 1828? Das fragt
K. J. |||
Also: "
Topographische Aufnahme der
Rheinlande" ||| Auch kurz benannt als "Tranchotkarte"
. ||| Hier vor allem vielleicht aus der
Blattnummer
103 / 46 (rrh. =
rechtsrheinisch) [X],
offenbar
diese von 1818/1819 [X], Blattname
"Godesberg /
Königswinter" [X].
Es gibt aber
auch noch "Duisdorf / Bad Godesberg / Königswinter", Blattnummer
102/46r. r. auch für rechtsrheinisch. (Und: Rheinland-Pfalz hat
wohl den einen Teil der Karten in seinem online-Geo-Dienst, NRW aber
den anderen. [X] ||| Diverse Quellenangaben wären
anscheinend möglich, z. B. "Geoportal RLP" ©GeoBasis-DE /
LVermGeoRP (Jahr des
Datenbezugs: 2023 ), Lizenz: dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de (wenn K.
J. das halbwegs richtig verstanden hat, sehr kompliziert formuliert
dort) ... aber die
preußischen Urkarten, zumindest diese, als
Originale, die liegen offenbar in der Staatsbibliothek Berlin. [X] Ach
ja: Wikimedia Commons bietet etliche Tranchot-Karten-Ausschnitte
"gemeinfrei" zum Download und zur Nutzung. ||| K. J. grüßt
an dieser Stelle den Tranchot-Obelisken auf dem Lousberg in Aachen, ja,
er steht auf Stadtgebiet, Nordrand Innenstadt. Belvedereallee. 52070
Aachen. Lousberg: Open-Street-Maps-
Direkt-Link ©
OSM-Mitwirkende.
1815 ||| Mit Ende des Wiener Kongresses am 9. Juni 1815
(Beschlüsse
in der Kongressakte vom 8.6.1815) wurde das
gesamte Rheinland endgültig ein Bestandteil des Königreichs
Preußen.
1815 ||| Gründung der Liedertafel zu Leipzig
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1815 ||| 30.4.1815 |
 Hochzeit von den (später dann)
Eltern des W. M. v. K., Hochzeit von den (später dann)
Eltern des W. M. v. K.,  Hochzeit
in Bodendorf an der Ahr, am 30.4.1815 [Quelle: Taufurkunde
zu
Sohn Wilhelm alias W. M. v. K. in
lateinischer Sprache, Urkunden-Text als Druckschrift in Quelle B, Bd.
1, S. 378, und oben im Kopf dieser Homepage-Seite]. Es sind Johann
Georg (J. Georgius) Müller und Johanna
Katharina (Joanna Catharina) Fuchs, die heiraten.
Hochzeit
in Bodendorf an der Ahr, am 30.4.1815 [Quelle: Taufurkunde
zu
Sohn Wilhelm alias W. M. v. K. in
lateinischer Sprache, Urkunden-Text als Druckschrift in Quelle B, Bd.
1, S. 378, und oben im Kopf dieser Homepage-Seite]. Es sind Johann
Georg (J. Georgius) Müller und Johanna
Katharina (Joanna Catharina) Fuchs, die heiraten.
|
_ |
1815 ||| Beim Wiener Kongress 1815 erhielt
Preußen einen
Teil
seines alten Staatsgebietes zurück. Die Zuordnung des Rheinlands
zu Preußen wurde mit der Unterzeichnung der Wiener Kongressakte
am 9. Juni 1815 völkerrechtlich besiegelt. (Neu hinzu kamen 1815
Schwedisch-Pommern, der nördliche Teil des Königreichs
Sachsen, die Provinz Westfalen und
die Gebiete der späteren Rheinprovinz.) Die Rheinprovinz
entstand dann formal aber erst 1822 aus der Vereinigung der 1816
gebildeten Provinzen
Großherzogtum Niederrhein und Jülich-Kleve-Berg. Die
Rheinprovinz gliederte sich nun in die fünf Regierungsbezirke
Aachen, Düsseldorf, Koblenz, Köln und Trier.


NUN AB DER
GEBURT VON W. M. v. K.
 Auf einer
Postkarte
von um 1900 findet sich als Teil der Postkarte dieses Bildnis von
"Hotel Rieffel". Mit der Postkarte warb der damalige (neue)
Besitzer J.
B. Altenburg. "Wie verlautet, ist das auf der Hauptstraße
gelegene Hotel Rieffel an einen Herrn Altenburg verkauft worden." Das
konnte man nämlich am 26.5.1900 im "Echo des Siebengebirges"
lesen. [X] Rechts im Bild ist auch die Tafel zu sehen, die
früher, angebracht an diesem Haus, an die Geburt 5.3.1816 (und nicht 15.3. !!!) von
Wolfgang
Müller (hier also ohne den Zusatz "von Königswinter")
erinnerte. 1816 war es wohl noch kein Hotel. ||| An Stelle des Hotels
in der Hauptstraße, heute ist
es
die Hauptstraße 403 ... (früher waren die Nummern aber
anders,
HOTEL RIEFFEL war früher, am selben Ort!, auch mal die Hausnummer
148, dort in
Königswinter) ... da findet sich allerdings heute ein Neubau mit
Wohnungen,
Arztpraxen und unten einem Supermarkt. Kein Auf-W. M. v.
K.-Hinweisschild mehr!!! [X]
Auf einer
Postkarte
von um 1900 findet sich als Teil der Postkarte dieses Bildnis von
"Hotel Rieffel". Mit der Postkarte warb der damalige (neue)
Besitzer J.
B. Altenburg. "Wie verlautet, ist das auf der Hauptstraße
gelegene Hotel Rieffel an einen Herrn Altenburg verkauft worden." Das
konnte man nämlich am 26.5.1900 im "Echo des Siebengebirges"
lesen. [X] Rechts im Bild ist auch die Tafel zu sehen, die
früher, angebracht an diesem Haus, an die Geburt 5.3.1816 (und nicht 15.3. !!!) von
Wolfgang
Müller (hier also ohne den Zusatz "von Königswinter")
erinnerte. 1816 war es wohl noch kein Hotel. ||| An Stelle des Hotels
in der Hauptstraße, heute ist
es
die Hauptstraße 403 ... (früher waren die Nummern aber
anders,
HOTEL RIEFFEL war früher, am selben Ort!, auch mal die Hausnummer
148, dort in
Königswinter) ... da findet sich allerdings heute ein Neubau mit
Wohnungen,
Arztpraxen und unten einem Supermarkt. Kein Auf-W. M. v.
K.-Hinweisschild mehr!!! [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.)
|
|
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1816 ||| 5.3.1816
|
* Geburt des W. M. v. K. am
5.3.1816, in Königswinter
am Rhein, Dienstag, nachts um 1 Uhr, als erster Sohn
des Arztes Johann Georg Müller und von Johanna
Katharina Müller geb. Fuchs: Peter
Wilhelm Carl Müller heißt das Baby (und der später mal
als
"Wolfgang
Müller von Königswinter" bekannte Schriftsteller)
bürgerlich. Rufname aber offenbar Wilhelm
Müller.
+ gestorben ist W. M. v. K. am 29.6.1873 in Wadenheim (erst 1875
offiziell Neuenahr heißend), genauer: in Beul, welches heute
Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist. Dort liegt auch der Kurpark.
[Geburtsurkunde und Taufurkunde verweisen auf den
* 5.3.1816, nicht auf den 15.3.1816 !!!,
Wortlaut
beider Dokumente in
Druckschrift z. B.
in Quelle B, Bd. 1, S. 378]. (Geburtsurkunde im Original befindet sich
offenbar im Stadtarchiv Königswinter.)
Das Geburtshaus (abgerissen, Neubau, Standort war die heutige
Hauptstraße Nr. 403) firmierte später als "Hotel Rieffel",
"Alt Heidelberg" und "Hotel Adler". [X]
|
|
* 15.5.1816
Geburt
des Malers
Alfred Rethel, Müllerfreund in Düsseldorf, er wird am +
1.12.1859 in Düsseldorf sterben.
Müller sollte dann
über ihn
das Buch "Alfred Rethel. Blätter der Erinnerung" schreiben. 1861
erscheint es. 185 Seiten.
|
1816 ||| Es wurde in Preußen das Verbot der
politischen
Vereine
bestätigt und auf die neuen Landesteile ausgedehnt. Erst über
die Revolution 1848 kam es zur Vereinsfreiheit.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1818 ||| 13.9.1818
|
* 13.9.1818 Geburt
der W. M.
v. K.-Schwester Wally
(Walburga Caroline)
Müller in Königswinter, später verheiratet zu
Wally
Becker. So steht das Datum auf Grabplatte auf dem Hauptfriedhof
Frankfurt, von K. J. selber vor Ort am 14.9.2023 gecheckt und
fotografiert. [X]
[Hinweis 1: In Quelle D, S. 9, Fußnote 37, steht allerdings
2 x anderes: a) 13.9.1817
und b) Pauline statt
Caroline.] [X]
Heirat mit Jacob Becker, dem Maler und später Professor, war laut
Graumann am 12.5.1838. [Sabine Graumann beruft sich bei ihren Angaben
auf Informationen des Ur-Ur-Enkels von Wally: Lodwig Graf
Schimmelpenninck in den
Niederlanden ... und auch noch auf Freifrau und Freiherr, also Bettina
und
Johann
Philipp, von Bethmann, Frankfurt. Und auf das Stadtarchiv
Kronberg/Taunus.] [X] Zugleich: Das Becker-Grab ist ein Ehrengrab in
Frankfurt. Die Daten werden dann doch auch stimmen. [X]
Wally Becker hatte u. a. die Tochter Maximiliane, die den erfolgreichen
Eugen Lucius der späteren Höchst-Werke heiratete. Aus dieser  Maximiliane-Eugen-Ehe
ging eine Eugenie Wally Marianne Lucius (1864–1941) hervor, die in
die Niederlande zur bedeutenden Familie Schimmelpenninck (hier: Maximiliane-Eugen-Ehe
ging eine Eugenie Wally Marianne Lucius (1864–1941) hervor, die in
die Niederlande zur bedeutenden Familie Schimmelpenninck (hier:
Lodewijk
Hieronymus Graf/graaf Schimmelpenninck)
hin(ein)heiratete.
Die Tochter dieses neuen Schimmelpenninck-Paares wiederum
verklammerte sich dann wieder zurück Richtung Hessen mit dem
Bankhaus Bethmann. Denn:
Simon Moritz Freiherr von Bethmann (1887–1966) heiratete  1914
diese Maximiliane Gräfin Schimmelpenninck (1889–1966). Letztlich
sind es auch alle Angehörige der Familie des W. M. v. K., alles
weitverzweigt, Bethmann ist ja auch wieder mal ein großes
Bankhaus. [X] 1914
diese Maximiliane Gräfin Schimmelpenninck (1889–1966). Letztlich
sind es auch alle Angehörige der Familie des W. M. v. K., alles
weitverzweigt, Bethmann ist ja auch wieder mal ein großes
Bankhaus. [X]
[Hinweis 2: Laut Grabstein in Frankfurt aber sieht es für Wally
Becker nach Geburt * 13.9.
aus,
zudem deutlich nach 1818. Also *13.9.1818.] Siehe dazu das verkleinerte
Foto hier unten.
[X]
|
+ Tod der Schwester von W. M. v. K.
Wally
Becker, geb. Müller, in Kronberg/Taunus, war offenbar am + 7.
September 1905, z. B. nach Angaben auf der Gussplatte
im Grabstein auf dem Hauptfriedhof Frankfurt/M. [X] Angaben zum Tod
wie 1912 (laut ADB und DNB = Deutsche Nationalbibliothek,
gnd/116105267) scheinen,
zumindest laut Datum auf
dem Grabstein/Gussplatte, nicht
zuzutreffen.[X]
Auch die Quelle D, S. 9, siehe links die Angaben, weist auf den +
7.9.1905 als Todestag hin, Ort des Todes auch hier: Kronberg/Taunus.
[X] Bzw. Cronberg in der alten Schreibweise.
Das Grab findet sich in Gräberfeld F, Nummer 143, gar nicht so
weit von dem Mausoleum Reichenbach-Lessonitz, einem auffälligen
und stattlichen Bau in rotem Sandstein. Man muss nur da
weitkreisig herumgehen und stößt bald auf das Ehrengrab zu
Maler und
Städel-Professor Jacob Becker, "Becker von Worms". |
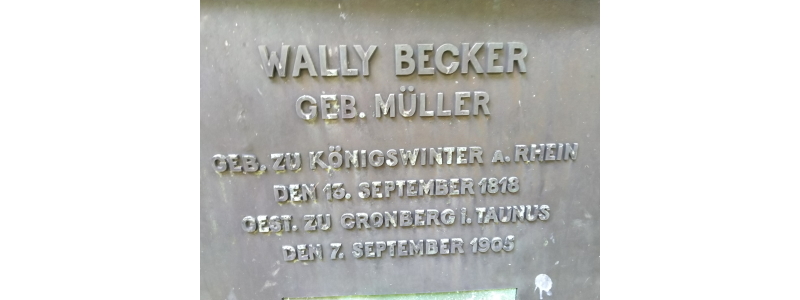
Diese
Grabplatte findet man bei dem
Grab des Malers Jacob Becker und seiner Ehefrau Wally Becker, geborene
Müller. Sie ist die Schwester des W. M. v. K. Das Foto stammt vom 14.9.2023 und wurde
von K. J. selber auf dem Hauptfriedhof Frankfurt/M. gemacht. [X]
1818 ||| Der heutige
Musikverein Düsseldorf hatte im
"Bürgerchor" (gegründet 1818) seinen Vorläufer. Name
heute: "Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e. V. gegr.
1818".
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1819 |
* Geburt der Müller-Schwester
Maria Gertrudis Müller im Jahr 1819 in Königswinter.
Sie war
nach Wilhelm (alias W. M. v. K.) und Wally/Walburga das dritte Kind von
Johann Georg Müller und Johanna Catharina/Katharina Müller
geb. Fuchs.
+
Tod der Maria Gertrudis Müller am 15.6.1826 in Bergheim. Im Alter
von sieben Jahren. Bruder W. Müller wird den Tod Jahre später
noch in einem Gedicht verarbeiten.
|
[Laut Quelle D, S. 26, Fußnote
122, findet sich die Sterbeurkunde als Nr. 31/1826 im Landesarchiv NRW,
Brühl (mittlerweile ist die Abteilung Rheinland nach Duisburg
umgezogen, K. J.)] [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1820 |
Schwere
Erkrankung der gesamten
Müller-Familie in Bergheim. ||| Und im November 1820 hat
Johann
Georg Müller auch noch einen Unfall gehabt.
|
[Quelle D, S. 25, Urquelle dazu
offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer Kulturbesitz,also:
GStA PK I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 75vor.] [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1821 ||| 3.2.1821 |
* Geburt
des W. M. v. K.-Bruders Eduard, also: Eduard Wilhelm Salentin
Müller. * 3.2.1821 in Bergheim. [Laut Quelle D, S. 23,
Fußnote 107, ist die Geburtsurkunde Nr. die 8/18121 für
Bergheim und ist im Landesarchiv NRW, in Brühl (mittlerweile war
aber der Umzug
der Abteilung Rheinland nach Duisburg, K. J.) zu finden.] |
Eduard Müller, der Bruder, soll in Antwerpen beim Bruder
des Vaters, bei Peter Wilhelm Müller, eine Ausbildung zum Kaufmann
gemacht haben und später in die Vereinigten Staaten gegangen sein.
[Das steht zum Beispiel in Quelle D, Seite 26, Fußnote 123.
Sabine Graumann beruft sich aber auch oft auf (Ur-)Quelle B.]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1821 ||| 16.3.1821 |
Brief von Johann Georg Müller
an
die Regierung, Sitz Köln, er möchte
aus der
Kreisphysikus-Stelle Bergheim entlassen werden, er könne
nicht
mehr reisen, nicht mehr über Land reiten, was aber für die
Stelle in
Bergheim nötig wäre.
|
[Quelle D, S. 25, Fußnote 116,
Urquelle dazu offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer
Kulturbesitz, also. GStA PK I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 59vor–Bl.
60
rück.] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1821 ||| 28.4.1821 |
Dem Rücktrittsgesuch
des Johann Geogr Müller als Kreisphysikus in Bergheim wird
stattgegeben. Er bekommt die Erlaubnis, sich in Köln als
Arzt niederzulassen. ||| Offenbar hatte J. G. Müller am 14.4.1821
noch einen (weiteren) Sturz.
[K. J. fragt sich, ob eventuell die Stürze deshalb berichtet
wurden, oder als sehr schlimm
berichtet wurden, um auf diese Weise
Bergheim und diese Stelle endlich verlassen zu dürfen. Die
Stürze also als bewusst eingesetzer Anlass und auch Grund.]
J. G. Müller hatte aber auch schon am 26.4.1821, zwei Tage vorher,
einen neuen Brief
abgesandt: Nun will er gar nicht mehr nach Köln, sondern (doch) in
Bergheim bleiben. U. a. spricht er von den "greisen armen Eltern", die
von seinem Lohn abhängen.
[K. J. fragt sich, ob nun wirtschaftliche Überlegungen, wie man
die Gesamtfamilie Müller finanziell über Wasser halten werde,
zu diesem erneuten Umschwung geführt haben könnten. Denn
glücklich schien die Familie dort in Bergheim nicht geworden zu
sein.]
|
[zu: 28.4.1821: Quelle D, S. 25,
Fußnote 117,
Urquelle dazu offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer
Kulturbesitz, also: GStA PK I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 63vor.
||| Zu Brief
des Arztes vom 26.4.1821, selbe Quelle, aber Bl. 67vor. ] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1821 ||| 24.5.1821 |
Nun wird plötzlich die "Bestallung" als Kreisarzt für
Bergheim erneuert. Johann Georg Müller geht nicht als
niedergelassener Arzt nach Köln, sondern bleibt in Bergheim im Amt.
|
[Quelle D, Seite 25/26,
Fußnote 119,
Urquelle dazu offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer
Kulturbesitz, also: GStA PK, I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 69vor.]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1821 ||| 15.10.1821
|
 Hochzeit
der späteren
Schwiegereltern des W. M. v. K.: Es heiraten Carl/Karl Eduard
Schnitzler, kurz Eduard Schnitzler, und Wilhelmine Stein. ||| Kinder
werden sein: Eduard Julius | Robert (später übrigens ein
Zeuge der
Sterbebeurkundung zu W. M. v. K.s + Tod in Beul/Wadenheim, heute Bad
Neuenahr, im Jahr 1873) | Ernst Otto | Emilie
(sie heiratet 1847 den W. M. v. K.) | Helena? | Karl Arnold? Hochzeit
der späteren
Schwiegereltern des W. M. v. K.: Es heiraten Carl/Karl Eduard
Schnitzler, kurz Eduard Schnitzler, und Wilhelmine Stein. ||| Kinder
werden sein: Eduard Julius | Robert (später übrigens ein
Zeuge der
Sterbebeurkundung zu W. M. v. K.s + Tod in Beul/Wadenheim, heute Bad
Neuenahr, im Jahr 1873) | Ernst Otto | Emilie
(sie heiratet 1847 den W. M. v. K.) | Helena? | Karl Arnold?
1822 wird der oben erwähnte Gatte Karl Eduard
Schnitzler (1792–1864) Teilhaber bei
dem
Kölner Handelsgeschäft „J. H. Stein“ (Stein = Familie seiner
Ehefrau), welches später zur
Bank
umgewandelt wird. [Quelle F]
|
Wilhelmine Stein (* 7. März
1800 in Köln; + 25. Dezember 1865
ebenda) war die Tochter ... des Johann Heinrich Stein, Gründer des
späteren Bankhauses J. H. Stein (J. H. Stein verstarb bereits vor
der
Hochzeit seiner
Tochter, 1820) ... und der Katharina Maria Peill (1778–1854).
Sie heißt nach der
Hochzeit möglicherweise Wilhelmine
Schnitzler-Stein, und nicht nur Schnitzler, darauf deutet
zumindest eine
Widmung von W. M. v. K. in seiner
Publikation "Vier Burgen", 1862, hin. [X]
|
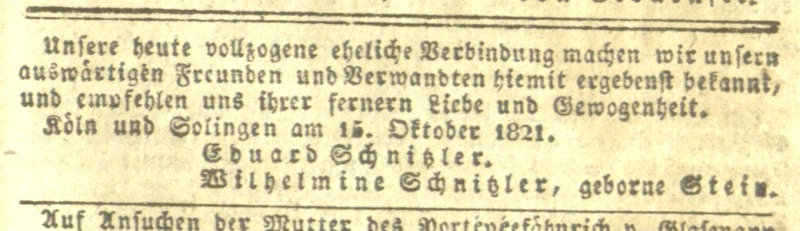
Hier
sehen wir die Hochzeitsanzeige (Hochzeit  war am 15.10.1821)
Schnitzler/Stein in der Kölner Zeitung "Welt- und Staatsbote" vom
18.10.1821.
Dieselbe Anzeige findet sich auch in der "Kölnischen Zeitung",
allerdings
vom 20.10.1821. [X]
war am 15.10.1821)
Schnitzler/Stein in der Kölner Zeitung "Welt- und Staatsbote" vom
18.10.1821.
Dieselbe Anzeige findet sich auch in der "Kölnischen Zeitung",
allerdings
vom 20.10.1821. [X]
| Jahr | evtl.
Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1822 ||| 9.2.1822
|
+ Tod
der Müller-Großmutter
Johanna Walburga Fuchs, geb.
Jansen, am + 9.2.1822 in Bodendorf an der Ahr.
Ehemann Johann
Peter
Fuchs, Müllers Opa mütterlicherseits, war bereits +
19.12.1813
verstorben, also noch vor der * Geburt von W. M. v. K. 1816.
[Quelle B, Bd. 1, S. 8 und Ahnentafel Fuchs vom Heimatarchiv Bad
Bodendorf.]
W. M. v. K. s Vater Johann Georg Müller verkauft
1822
seine letzten Weinberge/Grundstücke in Königswinter. Offenbar
um in Bodendorf aus dem Nachlass seiner Mutter Land von ebenfalls
erbenden Verwandten etwas anzukaufen. (?) Oder um anderes in Bodendorf
aufzukaufen. (?)
Vererbt worden war der Familie (eher wohl der Johanna Katharina,
Müllers Mutter) nach dem Tod von Johanna Walburga Fuchs offenbar
der "Landskroner Zehnthof".
(Siehe Zitat direkt hier unten.)
Zitat zum späteren Neubau der Müller-Familie in Bodendorf,
Hauptstraße 138: "Das
Haus ist nicht allein deswegen bemerkenswert, weil es deutlich
außerhalb des alten Dorfkerns errichtet worden, zudem sehr gut
erhalten
und stilistisch in einer Reihe mit dem jetzigen Pfarrheim und Feys Haus
zu sehen ist, sondern weil die Erbauer die Eltern des später
berühmten
rheinischen Dichters Wolfgang Müller von Königswinter gewesen
sind, die
durch Erbschaft zunächst Mitbesitzer des Landskroner Zehnthofs
waren." [Zitat aus Dr. Jürgen Haffke, Text "Sinzig-Bad
Bodendorf", Homepage-Stand: 03-Apr-2021, abgerufen am 1.4.2023. Direkt-Link] Weiteres
Zitat daraus: "Dass auf dem Gelände der drei Häuser
Hauptstraße 107, 111 und 113 der Landskroner Zehnthof gestanden
hat, lässt sich nicht mehr unmittelbar erkennen."
1802 Ersteigerung, und dann
1822ff. Vererbung des "Landskroner Zehnthofes" in der Familie
Fuchs/Müller, denn wir
lesen bei >>Die Landmessung von 1792 und andere
Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr. Karl August Seel, Heimatjahrbuch
des Kreises Ahrweiler 1992<<, ab Seite 55 findet sich der
Gesamttext, konkret zu dem Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10: "Dr. Georg Müller, Düsseldorf.
Schwiegersohn des Jean Peter Fuchs aus Bonn und Vater des seinerzeit
berühmten rheinischen Dichters Wolfgang Müller zu
Königswinter. Fuchs ersteigerte
1802 von Freiherr vom Stein den
Landskroner Zehnthof in Bodendorf (Hauptstraße 109, 111, 113). Das
Haus Hauptstraße 138 wurde später von
Müller als
Feriendomizil (um 1835) erbaut. Dort ist der abgebildete Stein
aufgestellt, zwei weitere sind bekannt." [Frage K. J.: Was wurde
aus
dem Zehnthof, nachdem Johann Georg Müller, der Arzt-Vater von W.
M. v. K. bzw. eher seine Ehefrau Johanne Müller, geb. Fuchs,
diesen geerbt hatte? Verkauft? Abgerissen? Warum? Wann?]
|
Großmutter mütterlicherseits
zu W. M. v. K. war Johanna Walburga Fuchs, geb. Jansen, * 20.2.1764,
Rees | + 9.2.1822 Bodendorf.
Großvater mütterlicherseits zu W. M. v. K. war Johann Peter
Fuchs, * 23.1.1756 Köln | + 19.12.1813 Bodendorf.
[Angaben laut Quelle B, Bd. 1, S. 379, aber auch laut Ahnentafel Fuchs
vom Heimatarchiv Bad Bodendorf.]
|
27.6.1822 ||| Formaler
Beginn
der
"Rheinprovinz" als Teil von Preußen, aber bereits ab 1815, Wiener
Kongress, gehörten diejenigen Gebiete, die 1822 zur "Rheinprovinz"
wurden, schon zum Königreich Preußen.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum passierte
|
1822 ||| 11.7.1822
|
* Geburt von W. M.
v. K.s
späterer Ehefrau
Emilie Schnitzler in Solingen. *
Am 11.7.1822 [X] (am Abend um
acht Uhr) in Solingen, +
gestorben ist sie am 2.6.1877 mit 54 Jahren.
[Geburtsurkunde bzw. Abschrift dazu vom 23.10.1847, Abschrift wurde
vermutlich für
die Hochzeit Emilie/Wilhelm (alias Wolfgang) im November 1847
angefertigt, in
Quelle C] [als Druckbuchstaben-Text auch in B, Bd. 1, S. 410, in Anm.
35] [X]
|
Der
Linzer (hier: das Linz am Rhein) Männer-Gesang-Verein (MGV) wird
1822
gegründet.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1822 ||| 7.12.1822
|
*
Geburt von W. M. v. K.s Bruder Karl Müller in
Bergheim an der Erft. *
7.12.1822. Er wird dort auch sterben, in jungen Jahren. Als
Kind. [Quelle B, Bd. 1, S. 380] Und zwar 1826. [Laut Quelle D.]
W. M. v. K. war 1816 der Erstgeborene. Seine sechs Geschwister waren a)
Wally/Walburga Müller,
* geboren in Königswinter 1818, + Tod
1905 Kronberg/Taunus b) Maria
Müller,
* geboren in Königswinter 1819, + Tod in Bergheim 1826 c) Karl
Müller, * Geburt 1822 in Bergheim, + Tod 1826 in Bergheim
d) Heinrich
Müller, * Geburt und + Tod am gleichen Tag, am 15.9.1824, in
Bergheim e) Eduard Müller,
* geboren 1821 in Bergheim, + Tod
vermutlich in den Vereinigten Staaten
f) August Müller bzw. Ludwig
August Müller * geboren 1827 in Bergheim, + Tod noch
unklar, spielte in Frankfurt bei der Vor-Gründung zur
späteren
Hoechst AG eine wichtige Rolle.
(Zusammen waren es sieben
Kinder/Geschwister.) [X]
Dieser letzgenannte August bzw. Ludwig August Müller (oder August
Ludwig Müller?) wird als
Mit-Geldgeber zu den drei Eignern/Gründern der
Teerfarbenfabrik/Anilinfabrik in Hoechst gehören:
"Theerfarbenfabrik Meister Lucius & Co." Sie ist der
Vorläufer der heute weltberühmten HOECHST AG, die aber so
nicht mehr heißt. [X]
|
HINWEIS AUF SPÄTER: 1828 zieht die
Familie Müller von
Bergheim nach
Düsseldorf. W. M. v. K. war aber schon vorab, ab 1827, (alleine)
dort, um
die
Schule/Gymnasium in Düsseldorf zu besuchen. Er wohnte dazu bei
einem Onkel. |
1823 ||| Gründung
eines
Gesangsvereins in Schwäbisch Gmünd.
1823 ||| Gründung der
Hamburger Liedertafel.
1823 ||| Gründung des
Festkomitees Kölner Karneval als
„Festordnendes Comites“ – und Gründung von
Karnevalsgesellschaften, als ein Beispiel (heute als) „Die Grosse von
1823 Karnevalsgesellschaft e. V. Köln", sie gilt als erste
Kölner Karnevalsgesellschaft, als ein weiteres Beispiel die Roten
Funken
... heute offiziell als "Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.
V." ||| Zugleich erster offizieller Karnevalszug. 2023 feierte man das
200-jährige Karnevals-Jubiläum in Köln, auf dem
Rosenmontagszug fuhr der "Heldenwagen" des offiziellen Zuges 1824 als
Nachbau mit. ||| Der Delphinwagen (Farbe golden!) von 1824 ist eine
Persiflage zum Motto „Thronbesteigung des Helden Karneval“ und ist
zugleich eine Hommage an die Geburtsstunde des Rosenmontagszugs. Der
erste „Held Carneval“, Ciolina Zanoli, wurde in diesem Gefährt
damals um den Kölner Neumarkt (den gibt es ja heute noch) gefahren.
1824 ||| Basler Gesangsverein
gegründet, heute der älteste noch
bestehende Chor in der Schweiz.
1824, Mai ||| Gründung des Stuttgarter
Liederkranzes, unter
den
Gründern auch Gustav Schwab. HINWEIS: In seinem (Schwabs) und
Chamissos
Musenalmanach
werden 1836 zwei Gedichte von Müller publiziert. [X] In 1836 gab
es mit Schwabs und Chamissos Buch namens Musenalmanach zugleich wohl
die
erste gedruckte
Müller-Publikation überhaupt. [X]
1824 Düsseldorf ||| 1824 druckte die
Düsseldorfer
Zeitung
– ganz ähnlich wie die Kölnischen Zeitung – zum Kölner
Karnevalsmotto "Der Besuch der Prinzessin Venetia beim Helden Carneval"
Karnevalsprogramme, fiktive Gesandtenberichte, Manifeste u. ä. ab.
[Quelle M, S. 59]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1824 ||| 19.9.1824
|
* Geburt
von Bruder Heinrich
Müller in
Bergheim an der Erft. * 19.9.1824. Auch er wird, wie Karl, dort
aber dann sterben, in
jungen Jahren. Als Kind. (Zudem stirbt in Bergheim noch Schwester
Maria.)
1828 zieht die "Restfamilie" Müller dann nach Düsseldorf. (W.
M. v. K. war schon vorab und allein 1827 dorthin gezogen, um das
Gymnasium zu besuchen. Er wohnte bei einem Onkel.) [Quelle B, Bd. 1, S.
380]
|
Ende 1824: Kreisphysikus und Vater
Johann Georg Müller wird für den Kreis Bergheim mit
der Aufgabe betraut, eine Übersicht der
Gesundheits- und Krankheitsverhältnisse mit Blick auf die
geografische Umwelt zu verfassen, auch mit Bezug zu den
alltäglichen
Lebenssituationen der Menschen.
[Quelle D] Er hatte dies bereits 1814 für Königswinter getan.
Als Cantonsphysicus damals. [Siehe auch bei D ganz unten auf dieser
Homepage-Seite.]
|
1826 Düsseldorf |||
Es
schlossen sich „capabele Bürger“ zu einer losen
Carnevals-Vereinigung zusammen. [Siehe Chronik des AVdK.]
1826 Düsseldorf |||
Wilhelm
von Schadow wird Direktor der Düsseldorfer
Kunstakademie. Der Kreis um Schadow gilt als Beginn der
"Düsseldorfer Malerschule". Müller (W. M. v. K.) sollte
Schadow
natürlich später auch kennenlernen. Und: Düsseldorf wird
1826 Sitz des Provinziallandtags.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1826 ||| 15.6.1826 |
Maria Gertrudis Müller
stirbt.
Maria ist eine Schwester von W. M. v. K. ||| + Tod der Maria am +
15.6.1826 in Bergheim. Im Alter von sieben Jahren. ||| Müller wird
später zum Gedächtnis an diese Maria ein Gedicht schreiben.
Sie war demnach *1819 in Königswinter geboren worden.
|
[Laut Quelle D, S. 26, Fußnote
122, findet sich die Sterbeurkunde als Nr. 31/1826 im Landesarchiv NRW,
Brüh (mittlerweile ist die Abteilung Rheinland nach Duisburg
umgezogen, K. J.)] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1827 ||| 3.1.1827
|
* Geburt
von Bruder August
Müller in
Bergheim an der Erft. * 3.1.1827 [Quelle B, Bd. 1, S. 380].
Offenbar ist er als "Ludwig August Müller" dann später (als
Geschäftsmann) öffentlich
aufgetreten.
Oder als "L. Aug. Müller". Oder als "L. A. Müller".
Im
Buch
"Zum
stillen
Vergnügen" (1865) von W. M. v. K. steht eine Widmung an
seine 1865
(noch lebenden) Geschwister: "An
meine lieben Geschwister, Walli, Eduard und August." [X] W. M.
v. K. nannte den Bruder also August, nicht Ludwig, auch nicht Ludwig
August.
Wir finden in in der "Wiener Handels- und Börsenzeitung",
Mittwoch, 21.9.1859, Ausgabe Nr. 214, fortlaufende Seite 2075, einen
Hinweis auf "L. Aug. Müller": Es geht um eine "Agence commerciale
et industrielle Belgique". Sie vertritt in Russland belgische
Handelshäuser und Banken und Fabriken etc. Zugleich errichtete man
in Belgien eine "Agence russe", sie soll Aufträge aus Russland an
belgische Fabrikanten et al. vermitteln. "An der Spitze der
Brüsseler Agence steht Herr L. A. Müller, Chef des Hauses L.
Aug. Müller und Komp.", lesen wir. [X]
|
Ludwig August Müller ist 1863 einer von drei Gründern der
Firma "Meister, Lucius & Co", Vorläufer-Firma der Hoechts AG,
die Herren Meister und Lucius sind jeweils Ehemänner zu zwei
Müller-Nichten.
August bzw. Ludwig August Müller war aber
wohl mehr Geldgeber (Investor) und Geschäftsmann, nicht Chemiker,
und
dürfte deshalb nicht Teil des Firmennamens gewesen sein.
Vielleicht auch, weil er in damals Belgien ansässig war (???).
Aber er, Ludwig
August Müller,
hat mitgezeichnet. Siehe Bildauschnitt hier unten [X]
|
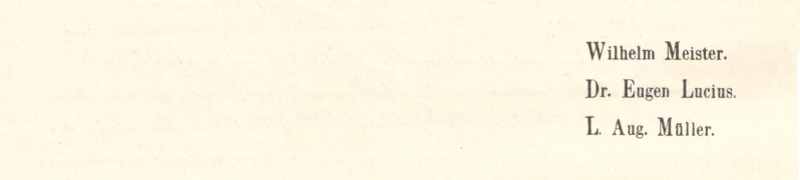
AUSSCHNITT
AUS EINEM BRIEF/RUNDSCHREIBEN. Januar 1863. Firma "Meister, Lucius
& Co.", Mitunterzeichner ist
W. M. v. K.-Bruder August bzw. Ludwig August Müller, Bildquelle:
Wikimedia Commons,
Datei:Hoechst_AG_Erstes_Rundschreiben_1863.jpg, abgerufen am 17.9.2023
[X] Siehe den Brief als Scan komplett auch hier: DIREKTLINK zu "Einige Personen zu und um Wolfgang
Müller von Königswinter". [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| Herbst 1827 |
W. M.
v. K. wird zuerst ganz alleine (!) von Bergheim nach
Düsseldorf gehen/umziehen, dort bei einem Onkel (Oheim)
namens Breitenstein (dessen Ehefrau war eine Schwester von W. M. v. K.s
Mutter) wohnen und
das Königliche Gymnasium unter Direktor Brüggemann besuchen.
[Quelle B, Bd. 1, S. 9] (Bis zum Abitur 1835 ist W. M. v. K. auf dem
Gymnasium. Siehe dazu weiter unten in dieser Zeitleiste.)
Es gibt
Jahres-Berichte für dieses Gymnasium, auch für 1827. Darin
steht J. H. Th. Brüggemann als (neuer) Direktor (und
Verantwortlicher für den Jahresbericht). Gedruckt bei der J. E.
Dänzer'schen Buchdruckerei 1827. [X] Der alte Direktor,
Konistorialrath Dr. Kortüm, wurde offenbar auf eigenen Wunsch von
seiner Position entbunden. Seite 19 [X] Das neue Schuljahr sollte am
11.10.1827 beginnen. Laut Seite 23.[X] Das alte Schuljahr, welches hier
im Jahresbericht den Kern bildet, begann am 26.10.1826. [X] Es ist von
328 Schülern insgesamt die Rede, aber unter Zählung der
Abgänge und Zugänge. [X] In der Sexta waren bei
Schuljahresende 56 Schüler. Seite 20. [X] Ordinarius in der Sexta
war Dr. Honigmann. ||| Aber Müller wird ja erst ab 11. Oktober
1827 (neues Schuljahr) das Gymnasium besucht haben.
|
Die Eltern und Geschwister werden erst
1828 nach
Düsseldorf umziehen. Erste Adresse offenbar Neustaße.
[Quelle B, Bd.
1, S. 9]
1835 wird W. M. v. K. seine Reideprüfung ablegen (Abitur), laut
Jahresbericht 1834/1835 ist Dr. Fr. Wüllner der Direktor.
|

Das einstige "Königliche
Gymnasium", wo W. M. v. K. Schüler war. Früher:
"Kurfürstliches Gymnasium“, letzteres 1803 aufgelöst und als
„Lyzeum“ fortgeführt. Am 20. Nov. 1805 zog dieses Lyzeum in
Räume des Klosters der Franziskaner an der Citadellstraße.
1814 wurde es durch die preußische Schulbehörde in das
„Königliche Katholische Gymnasium“ umgewandelt und umbenannt.
Es zog dann jenes KG/KKG im Jahr 1831
(?), offiziell offenbar 1833 – HINWEIS: Müller begann 1827 noch in
der Citadellstr.
am alten KG-Ort – die Schule zog dann innerhalb
Düsseldorfs um, im Neubau Alleestraße wird Müller 1835
seine
"Reifeprüfung" absolvieren. ||| Hier sehen wir in der
Bildmitte (hinter dem Baum)
den neuen Ort, den
Neubau, Bau begonnen 1824, das
neue Gymnasium, die Aufnahme ist allerdings etliche Jahrzehnte
später entstanden, von "um 1900".
||| Rechts dazu ist
das Hotel Breidenbacher Hof, Alleestr. 34, Ecke Bazarstraße Nr.
1, erbaut 1808–1812, links daneben das
Gymnasium, Adresse: Alleestr. 32. ||| Zusatz-Info: Alleestraße
36, hier
nicht mehr im Bild, noch weiter rechts, wurde (ab wann?) von dem
Hofkammerrath
Hermann Joseph Friedrich Beuth erbaut und bewohnt. ||| Zur
Alleestraße: Nach dem Ende des
Großherzogtums Berg 1813 wurde nach mehreren
Namensänderungen im 19. Jahrhundert (ab wann genau?) ein einst
neugeschaffener
"Boulevard Napoléon" endlich zur Alleestraße. Aber: Am 26.
September 1963 wurde dieser Name auch wieder in (bis heute gültig)
Heinrich-Heine-Allee
geändert |||
Zum Gymnasium: 1906 bereits sollte es allerdings wieder einen
Umzug des
Königlichen Gymnasiums geben.
In die Bastionstraße zwischen Königsallee und Breite
Straße. Siehe
dazu u. a.: Studien zur niederrheinischen Geschichte. Festschrift zur
Feier
des Einzugs in das neue Schulgebäude des Königlichen
Gymnasiums (30. Juni 1906). ||| Seit 1947 heiß eben diese Schule,
an der Müller mal lernte und die mehrfach umzog:
"Görres-Gymnasium", heute lang benannt als "Städtisches
Görres-Gymnasium". Offizielle Adresse heute: Königsallee 57.
40212 Düsseldorf. ||| Bildquelle: Wikimedia Commons. Direkt-Link
1829 Düsseldorf |||
Gründung des Vor-AVdK, nämlich: "Carnevalsverein pro 1829",
der sich später in "Allgemeiner Verein der Carnevals-Freunde"
umbenannte, heute heißt er: "Allgemeiner Verein der
Karnevalsfreunde e.V. gegründet 1829". W. M. v. K. wird
später ein Mitglied des AVdK sein. ||| Die Behörden wollten
damals den
Karneval in Düsseldorf unterdrücken. Die lose
Düsseldorfer Carnevalsvereinigung traf sich nämlich am 8.
Februar 1829, um 4 Uhr im Saale des Hofgartenhauses zur
Generalversammlung. Es war letztendlich die Gründungsversammlung,
und man gab sich den Namen "Carnevalsverein pro 1829", abgekürzt
"pro." Der AVdK war gegründet, wenn auch noch unter anderem Namen.
[ Siehe Chronik des AVdK. Und auch bei W. – Wikipedia beruft sich aber
für
diese Information auf: avdk-duesseldorf.de
] Nach der Gründung wurde der Verein von den Behörden aus
politischen Gründen mehrmals verboten.

Der
AVDK (Düsseldorf) von 1829, in dem schon Wolfgang Müller von
Königswinter (damals noch als Wolfgang Müller bzw. unter
seinem Geburtsnamen Carl Wilhelm
Müller) Mitglied war, ist rund 200 Jahre nach seiner Gründung
weiterhin aktiv. Hier sehen wir den Wagen auf dem Düsseldorfer
Karnevalszug (Rosenmontag) vom 12.2.2024. [X]
1829 Düsseldorf |||
Gründung des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen.
Er wurde durch Statut vom 23. Januar 1829 gegründet, damals noch
als "Kunst-Verein für die Rheinlande und Westphalen", einer der
ältesten deutschen Kunstvereine. Zu den Gründern gehören
der Akademie-Direktor (und Maler) Wilhelm von Schadow sowie der
Akademie‐Professor, Maler und Kunsthistoriker Karl Josef Ignatz
Mosler/Moßler. Zudem Regierungsrat Fallenstein. Grundidee war
wohl, die Geldmittel zum Ankauf von Kunstwerken über eine Art von
Genossenschaft zu organisieren.

"Blick in das Ahrtal bei Bodendorf"
von 1834/35, ein Gemälde des Eduard Wilhelm Pose. ||| Familie
Müller hatte eine Art
zusätzlichen Stammsitz für etliche (Ferien- et
al.-)Aufenthalte via Müllers Mutter Johanna Fuchs (diese war in
Bodendorf aufgewachsen, aber nicht dort geboren) und der
((Groß))Eltern Fuchs (dort in Bodendorf wohnend, der W. M. v.
K.-Großvater
Johann Peter
Fuchs war aber bereits 1813, vor W. M. v. K.s Geburt 1816, verstorben,
W. M. v. K.s Oma, Johanna Walburga Fuchs, geb. Jansen starb dann 1822).
W. M. v. K.s Vater
und Mutter bauten sogar noch um 1835 (???), beendet offenbar 1838, ein
eigenes Haus in Bodendorf,
eine
Mini-Villa,
für ihre Aufenthalte. ||| Das Bild hier malte Eduard Wilhelm Pose
(*
9. Juli 1812 in Düsseldorf | + 14. März 1878 in Frankfurt am
Main), er war ein Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule und
einer derjenigen, die unser angehender Schriftsteller und Dichter
Wolfgang Müller (damals noch als Wilhelm Müller unterwegs)
nach
Bodendorf mal mitbrachte, z. B. zur Weinlese. (Siehe weiter unten auf
dieser Webpage das Zitat
bei "Herbst 1834".) Man sehe sich das Bild von Maler Pose
größer an ... und zwar bei dieser Quelle: AHR-WIKI, hier der
Direkt-Link.
Dieses Bodendorf-Bild soll der Künstler E. W. Pose der Mutter von
W. M.
v. K. geschenkt haben. Das ergibt sich aus: »Blick in das Ahrtal
bei Bodendorf«
— Anmerkungen zu E. W. Poses romantischer Ansicht — Hildegard
Ameln-Haffke und Jürgen Haffke, in: Heimatjahrbuch des Kreises
Ahrweiler 1982. Seite 60–65. [X]
Direkt-Link zu diesem
ausführlichen Text-Beitrag über das Bild

Die
"Alte Akademie", Kunstakademie Düsseldorf, 1831 gemalt von
Andreas Achenbach (1815–1910) als "„Die alte Akademie in
Düsseldorf“
. Die Kunstakademie
befand sich von 1821
bis zu dem Brand 1872 im
Galeriegebäude des vormals kurfürstlichen Schlosses. (Danach der Neubau, 1875 bis 1879,
Adresse nun:
Eiskellerstraße 1, 40213 Düsseldorf
, an der Oberkasseler Brücke: Open-Street-Map-Direkt-Link
zur Kunstakademie heute. Dieselbe Adresse.) Müller
wird die
Achenbach-Brüder (auch Oswald Achenbach, 12 Jahre jünger) und
viele, viele Maler in Düsseldorf
kennenlernen, einige davon sind enge Freunde, über etliche wird
Wolfgang Müller von Königswinter schreiben. Und zusammen mit
den Künstlern (z. B. via "Künstlerverein Malkasten" ab 1848)
diverse Aktionen/Veranstaltungen/Publikationen et al. organisieren.
Bild-Quelle: Wikimedia
Commons, Public Domain  Direkt-Link zu diesem Gemälde des Andreas
Achenbach 1831. [X]
Direkt-Link zu diesem Gemälde des Andreas
Achenbach 1831. [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1834 ||| Herbst 1834 |
ZITAT W. M. v. K.: "In den Ferien des
Jahres 1834 hatte ich die Freude,
Alfred Rethel als Gast im Kreise der Meinigen zu Bodendorf an der Ahr
zu sehen, wo meine Eltern ein Weingütchen besaßen und
sich
gewöhnlich vor und nach der Traubenlese aufhielten. Da der
herrliche Herbst von 1834 ganz besondere Genüsse versprach, so
erhielt ich die Erlaubnis, einige Bekannte von Düsseldorf
mitzunehmen. Ich hatte in jener Zeit meine nächsten Freunde unter
den Künstlern und lud auch Rethel zum Besuch ein. Wir machten
diesmal eine Fußreise mit dem Ranzen auf dem Rücken. Der
erste Tag brachte uns von Düsseldorf nach Köln, wo wir die
Nacht im Kölner Hofe blieben. Am zweiten Tage gelangten wir nach
Bodendorf, wo wir fröhliche Zeiten verlebten und in lauter
Jugendlust Berg und Tal durchschwärmten. Altenahr und seine wilde,
felsige Umgebung, deren Besuch damals so recht in Mode kam und auch
seitdem die Mode geblieben ist, lockte die jungen Wanderer an, bei
welcher Gelegenheit dann der feurige rote Wein des Tales in Ahrweiler
sowie in St. Peter zu Walporzheim und beim lustigen Wirt Caspary in
Altenahr nicht ungekostet blieb." [Hier zitiert nach Quelle O.]
|
Müller schrieb zudem am 20.9.1834
einen Brief aus Bodendorf an den Freund (und später bekannten
Komponisten) Norbert Burgmüller: "Zu sechs sind wir angekommen,
Rethel, Pero, Zwecker, Körner, Müller (der Darmstädter
im wahren Sinne des Wortes) und meine Person." [Quelle B, Bd. 1, Seite
26 findet sich dieser Brief.] Der andere Müller ist ein
Namensvetter, vermutlich, so Biograph Luchtenberg, Andreas Müller,
dessen Vater in Darmstadt Galeriedirektor war.
Rethel ist der Maler
Alfred Rethel, über den Müller nach Rethles Tod ein Buch
veröffentlichen wird.
(Siehe weiter unten auf dieser Web-S(e)ite und bei der anderen
Homepage-Seite zu den Publikationen: Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen zu Wolfgang
Müller von Königswinter.)
|

Schloss
Ehreshoven (man findet bisweilen auch die Schreibweise "Ereshoven" ...
und auch "Ehreshofen"), unweit von Engelskirchen an der Agger, Bildnis
allerdings
hier von
1874 oder früher. W. M. v. K. hatte eine Liebelei mit Stephanie
von Nesselrode-Ehreshoven und war als Primaner auch einmal zu Besuch
auf dem Schloss. 1834/1835 etwa. ||| Bild-Quelle hier:
Wikimedia Commons, Direkt-Link zum Bildnis
zum Schloss
Ehreshoven an der Agger, nah zu Engelskirchen.
Demnach ist das Bild grob zwischen 1857 und 1883 entstanden. |||
JEDOCH: K. J. findet diese Buchreihe und auch die genaue Quellenangabe:
"Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der
ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie nebst
den königlichen Familien-, Haus-Fideicommiss-Schatull-Gütern
in
naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen
Darstellungen, nebst
begleitendem Text. Herausgegeben von Alexander Duncker,
Hof-Buchhändler
Seiner Majestät des Königs. Berlin, Verlag von Alexander
Duncker,
königlichem Hof-Buchhändler. ||| Verleger wäre dieser
Alexander Duncker
(1813-1897), also der Berliner Alexander Duncker. [X] Das Bild findet
sich als Bild 771 (zudem: Rhein-Provinz-Bild 86) in Band 13 der Reihe.
Hier wird das Schloss allerdings geschrieben "Ehreshofen", mit f. [X]
Nach einer Originalaufnahme von P. Vogel ausgeführt von Th.
Albert,
Druck bei Winckelmann & Söhne, das steht unter dem Bild in dem
Buchband. [X] Verlag von Alexander Duncker. Königlicher
Hofbuchhändler
von Berlin. [X] Band 13 datiert konkret 1873/1874, geschrieben in
römischen Zahlen. Das Schloss war laut der Angabe der Publikation
damals in der Rheinprovinz, im Kreis Wipperfürth. [X] Das Bildnis
müsste also vor
1874 entstanden sein. (Und wann das Foto, welches
als Vorlage für das Bildnis diente?) [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1835 ||| 2.2.1835 |
Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s "Berechtigungszeugnis" zum
einjährigen Militärdienst.
(Düsseldorf.) [Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
1835 in Düsseldorf. ||| Es
entsteht
ab etwa 1835, entlang der
Alleestraße und der Ratinger Straße, das erste
Galerienviertel des Rheinlands. |
Schon ab 1835(???) bauen sich offenbar Wolfgang Müllers Eltern ihr
eigenes
Haus in
Bodendorf an der Ahr. Dieses Bodendorf, wo Müllers Mutter Johanna
Catharina aufgewachsen war, und wo die Oma Johanna Walburga Fuchs bis
1822, bis zu ihrem Tod,
lebte, blieb für die Arzt-Familie, jetzt war deren Wohnsitz
die Stadt Düsseldorf,
immer ein Bezugspunkt, z. B. für Ferienaufenthalte, gerade auch
zur Weinlese. ||| Man hatte als Familie offenbar eigene Weinberge, die
dann nach
dem Tod der W. M. v.
K.-Oma 1822 irgendwie aufgeteilt wurden, falls es mehrere
Fuchs-Nachkommen gab. Das müsste man
wohl noch genauer recherchieren. Auch das Thema "Landskroner Zehnthof",
der von Oma Fuchs ((Johanna Walburga Everharda Fuchs, geborene Jansen,
* geboren
am 20.2.1764 in Rees | + gestorben am 9.2.1822 in Bodendorf))
vermutlich an die Müller-Mutter Johanna Katharina/Catharina,
geborene
Fuchs, verheiratet zu Müller seit 1815, vererbt wurde. Diesen Hof
hatte Johann (Jean) Peter Fuchs schon
1802
vom Freiherr vom Stein ersteigert. (Siehe weiter oben bei 1802.)
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| (um) 1835 |
Die
Düsseldorfer Arzt-Familie Müller, also die Eltern von W. M.
v. K., diese Familie baut ein neues Haus in Bodendorf.
Müller war vor
1835 als Junge und junger Mann dort, und er wird auch nach 1835 noch
häufig in Bodendorf sein.
"Das Haus
Hauptstraße 138 wurde später von Müller als
Feriendomizil (um 1835) erbaut.
Dort ist der abgebildete Stein aufgestellt, zwei weitere sind bekannt."
Das steht in dem Beitrag über "Die Landmessung von 1792 und andere
Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr. Karl August Seel, Heimatjahrbuch
des Kreises Ahrweiler 1992", ab Seite 55 findet sich der Gesamttext,
konkret findet sich diese Information von Autor Seel zu dem
Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10. [X]
|
Die W. M. v. K.-Mutter Johanna
Katharina wird
später sogar, nach dem Tod des ihres Mannes in Düsseldorf,
wieder nach Bodendorf ziehen, wo sie groß geworden war. ||| *
Geburt der Mutter von W. M. v. K. am 3.2.1795 in Anholt. Sie
heißt Johanna/Joanna Catharina/Katharina Fuchs. Sie stirbt am +
3.8.1876 in Remagen mit 81 Jahren.
[Quelle B, Bd. 1, S. 379] Sie heißt später Müller. Ihr
Ehemann wird ⚭ am 30.4.1815 Johann Georg Müller. ⚭ Heirat in
Bodendorf an der Ahr.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1835 ||| 10.9.1835 |
Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s Reifezeugnis des Gymnasiums in
Düsseldorf. [Quelle B, Bd. 2, S. 487]
Die öffentlichen Prüfungen des Gymnasiums waren für den
10. und 11.9.1835 angesetzt. [Siehe Jahres-Bericht des Gymnasiums
1834–1835, Titel-Seite, gedruckt bei der Dänzer'schen
Buchdruckerei 1835.] [X] Ordinarius der Prima war Prof. Dr. Hildebrand.
Seite 7. [X] Insgesamt gab es 284 Schüler in 1834/1835. S. 8. Die
Prima (dauert 2 Jahre) hatte übergreifend 35 Schüler. [X]
Alle 11 Primaner, die mit Reifeprüfung nun entlassen wurden (siehe
Namen hier in der rechten Spalte), wollten in Bonn studieren! [X] W. M.
v. K. aber als einziger das Fach Medizin. [X]
Am "Königlichen Gymnasium zu Düsseldorf" sind in einer
Publikation
von (bereits) 1833 genannt: Direktor Dr. Wüllner, zehn Oberlehrer,
darunter
Prof. Brewer, Prof. Hagemann, Prof. Budde, Prof. Hildebrand, Prof.
Crome, Dr. Durst, Dr. Hüllstett, Honigmann, Grasshof, Dr. Fichte
als provisorischer Oberlehrer, drei Lehrer (Hollmann, Dr. Capellmann,
Schmidts) und Wintergerst, als Inspektor der Kunstakademie und
Zeichnenlehrer. (Zu allen Lehrkräften ist die Wohn-Adresse
vermerkt.) Siehe: Offizielles Adress-Buch für Rheinland-Westphalen
1833, Adreß-Buch für Rheinland-Westphalen. Zum Vortheil
armer Kranken herausgegeben von Rüttger Brüning [...]
Elberfeld, gedruckt bei Lucas, I. Theil. Preuß. Rhein-Provinz.
Regierungs-Bezirk Düsseldorf, Seite 8 [X]
|
Siehe zum dem Gebäude der Schule
(eingeweiht 1833) weiter oben das Foto von um 1900.
Diese 11 Schüler machten im Sept. 1835 die Reifeprüfung am
Königlichen Gymnasium in Düsseldorf:
- Burgartz, Gerhard
- Ebermaier, Friedrich
- Kerris, Otto
- Krebs, Franz
- Lennich, Wilhelm
- Marcowitz, Wilhelm
- Müller, Wilhelm (ja, unser Müller!)
- Rattmann, Wilhelm
- Simon, Gustav
- Spiritus, Constantin
- Stommel, Leonhard
[Quelle Jahresbericht, S. 9, siehe Angabe hier in der Spalte links.] [X]
Die Entlassung fand am 11.9.1835 statt, im Rahmen des Tagesprogramms.
Nachmittags ab 15 Uhr gab es öffentliche "Redeübungen"
diverser Schüler, danach Gesang, Verabschiedung der 11 "zur
Universität Abgehenden", Gesang. S. 12 [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1835 ||| 1.11.1835
|
W. M. v. K. kommt von Bodendorf,
betritt ein Dampf-Schiff in Remagen, fährt nach Bonn, um nun am 1.11.1835 sein
Medizin-Studium dort real zu beginnen. Er wohnte erst am Markt,
direkt neben dem "Gasthof Goldener Stern". Also im Haus neben dem
Gasthof.
Die Immatrikulation von Müller war bereits am 21.10.1835,
Immatrikulation bei der medizinischen Fakultät. In der Namensliste
der Universität steht nur "Medizin". [Quelle: "Amtliches
Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der
Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Bonn für das Winter-Halbjahr 1835–1836", "Aufgestellt von
Krüger, erstem Pedell der Königlichen Universtät.", die
Namen aller Studenten sind quer durch die Fakultäten als ein
Konvulut alphabetisch geordnet.] [X] W. M. v. K. wohnte demnach in Bonn
bei der Adresse "1117 Markt". [X]
Im nächsten Verzeichnis für das Sommersemester 1836 wird
Müller aber mit der neuen Adresse "1 Stockenstraße"
geführt. [X]
Weitere Müller (der Name ist ja sehr häufig) an der
Universität Bonn, hier im Wintersemester 1835/1836, waren laut
diesem Verzeichnis: Adolph Müller (Jura), Matthias
Müller (Jura), Christoph Müller (auch Medizin!)
und Joh. Baptist Müller (Jura).
Es gibt rund 3 1/2 Jahre später ein
Universitäts- Abgangszeugnis für W. M. v. K. vom März
1839. [Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
Müller wird bis 1839 im
Frühjahr in Bonn studieren, dann erfolgt der Wechsel nach Berlin,
wo er als Arzt promovierte. Herbst 1840 wird er aber wieder zurück
in Düsseldorf sein, seiner damaligen Heimat, dort wohnten auch
seine Eltern. Müllers Vater starb 1842 in Düsseldorf, Sohn W.
M. v. K. wird die Praxis weiterführen.
Erst 1853 wird W. M. v. K. dauerhaft mit Ehefrau Emilie, geb.
Schnitzler, und Kindern umziehen, nach
Köln, wo sein Lebensmittelpunkt bis zu seinem Tod 1873 sein wird.
Emilie Schnitzler, Bankiers-Tochter, war bei der Hochzeit mit W. M. v.
K. Kölnerin, geboren wurde sie ... allerdings ... in Solingen.
|
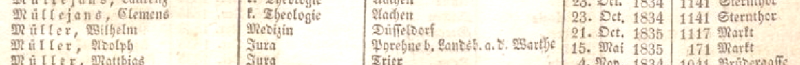
Wir
sehen in der Liste (AUSSCHNITT) Wilhelm Müller (der
sich später als Poet und Schriftsteller "Wolfgang Müller von
Königswinter" nennen sollte), hier erstmals als Student
auftauchen, in "Amtliches Verzeichniß des Personals und der
Studirenden auf der
Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Bonn für das Winter-Halbjahr 1835–1836". Er studiert Medizin,
wohnt noch (Herkunft/Hauptwohnsitz) in Düsseldorf, und er hat sich
am 21.10.1835 immatrikuliert. Seine erste Wohnung in Bonn ist "1117
Markt". [X] Am 1.11.1835 wird er von Bodendorf (Ahr) abreisen, um dann
via Schiff (Remagen) nach Bonn zum eigentlichen und realen
Studienbeginn
anzukommen. [X] Immatrikulation bei Müller also bereits
21.10.1835, sein realer Studiumsbeginn 1.11.1835.
Und hier unten im Ausschnitt aus dem Namensverzeichnis sehen wir, dass
der berühmte Karl Marx zeitgleich
an der Universität Bonn Jura studierte. Marx wohnte in Bonn auf
der "1 Stockenstraße", wo W. M. v. K. zum Schluss seines Studiums
wohnen sollte. Marx fand sich z. B. hier unten im Verzeichnis für
das Sommersemester 1836, immatrikuliert war Marx am 17.10.1835, also
vier
Tage vor Wilhelm (alias Wolfgang) Müller. Marx wechselt allerdings
bereits 1836 nach Berlin, Müller wird dieses 1839 tun. (Ob beide
sich kannten? Jura versus Medizin? Marx war vermutlich kein
Chorsänger wie Müller. Aber Marx spielte in Bonn auch den
Poeten, wie es W. M. v. K. ja auch tat:" In dieser Zeit schrieb
Karl Marx in seiner Begeisterung für die Romantik Gedichte und
kleinere literarische Arbeiten." So
liest man bei der Friedrich-Ebert-Stiftung.) ||| Man kann
natürlich Jahr
für Jahr, Semester für Semester, ermitteln, welche Menschen
zeitgleich in Bonn studierten und wo sie wohnten. Denn die
Uni-Verzeichnisse scheinen ab WS 1825/1826 vollständig zu sein.
[X] Wir sehen an dem
Ausschnitt unten auch: Wilhelm Markowitz aus Düsseldorf hat sich
am
selben Tag
wie unser Müller immatrikuliert: 21.10.1835. (Vielleicht fuhren
einige Düsseldorfer Abiturienten gemeinsam zur Uni Bonn, um sich
zu immatrikulieren.) Wir erinnern
uns: Diese 11 Schüler
machten im Sept. 1835 die Reifeprüfung am Königlichen
Gymnasium in Düsseldorf:
- Burgartz, Gerhard - Ebermaier, Friedrich - Kerris, Otto - Krebs,
Franz - Lennich, Wilhelm - Marcowitz,
Wilhelm - Müller,
Wilhelm (ja, unser Müller!)
- Rattmann, Wilhelm - Simon, Gustav - Spiritus, Constantin - Stommel,
Leonhard [Quelle Jahresbericht, S. 9, siehe die Angaben weiter oben bei
10.9.1835.] [X]
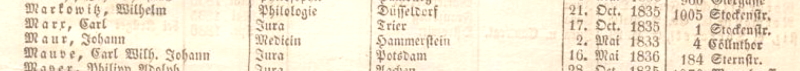
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1836 |
In Chamissos und Schwabs
"Musenalmanach"
werden
1836 zwei Gedichte von Müller
publiziert. [X] Wohl
die
erste gedruckte
Müller-Publikation überhaupt.
MÜLLER BERICHTET
SELBST DAVON SO: "Ich kann
meinen Eintritt in die deutsche Literatur als zusammenfallend
mit meinem Besuche der Universität Bonn im Herbste 1835
bezeichnen. Als ich noch Gymnasiast war, hatte Robert Reinik
einige meiner Lieder, an denen er Wohlgefallen fand, an Chamisso
geschickt, um sie dem von diesem Dichter und Gustav
Schwab herausgegebenen Musenalmanache einzuverleiben.
Nach
vollendetem Abiturienten-Examen machte ich eine Reise nach
Koblenz, um dort Verwandte zu besuchen. Als ich eines
schönen Tages die Stadt durchwandelte und an dem Bädekerschen
Buchladen stehen blieb, erblickte ich am Schaufenster die
neueste Ernte der deutschen Lyrik, die möglicher Weise auch
meine poetischen Erstlinge enthalten konnte, denn ich hatte von
Reinik keine bestimmte Antwort in Betreff der Aufnahme er
halten. Es waren seltsame Empfindungen, die über mich kamen. Das
Herz klopfte mir hörbar. Ich gerieth in die
äußerste Spannung. Die Neugierde, ob meine kleinen Gedichte
Gnade gefunden, und die Blödigkeit, mich davon zu überzeugen,
stritten lange Zeit in mir.
Endlich behielt die
Erstere
die Oberhand und trieb mich in den Laden, um mir das
Büchlein zeigen zu lassen. Als ich das Verzeichniß suchend
in dem goldschnittgefügten Bändchen blätterte, wurde es
mir
grün und blau vor den Augen. Und richtig, ich fand meinen
Namen. Zwei meiner Gedichte hatten die Censur passirt, es
waren dieselben, denen einst Professor Fichte in der Prima des
Gyumasiums den ersten Preis zuerkannt, und die er als wirkliche
poetische Erzeugnisse bezeichnet hatte." Zitiert nach dem W. M. v.
K.-Artikel-Text "Von der
rheinischen Poesie. (Aus den 'Denkwürdigkeiten'.), gedruckt Juli
1863, siehe ausführlicher hier: KLICKEN >>Ein paar Texte
von Wolfgang Müller von
Königswinter.<< [X]
Er schreibt darin auch etwas zu seinem Studiumsbeginn in Bonn. [X]
|
Es sind die Gedichte "Frühlingsvorzeichen",
Seite 257, und "Frühlingstraum", Seite 258. [X] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1836 ||| 8.4.1836
|
Jakob
Becker (der später bekannte Maler "Jakob Becker von Worms"),
erstellt ein Portrait von W. M. v. K., das früheste derzeit
bekannte Bildnis von Müller [laut Quelle B, Bd. 1, S. 383
unten].
Jakob Becker wird 1838 die
Schwester
von Wolfgang Müller heiraten: Walburga Müller, kurz: Wally,
manchmal auch Walli. (Jakob Becker, * 15. März 1810 in Dittelsheim
bei Worms | + 22. Dezember 1872 in Frankfurt am Main).
Das (Ab)Bildnis des W. M. v. K. findet
sich schwarz-weiß gedruckt in Quelle B, Bd. 1, zwischen Seite 96
und 97. [X] Das "Klischee" für den Druck 1959 wurde erstellt bei
Kaiser-Klischees Köln. [X]
|
Das Original des Bildes befindet sich
demnach im Kölnischen Stadtmuseum. [Quelle B, Bd. 1, S. XI]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1836 ||| 7.5.1836
|
In Aachen: Tod von August
Joseph Norbert
Burgmüller, Jugendfreund von W. M. v. K.: *
8. Februar 1810 in Düsseldorf | + 7. Mai 1836 in Aachen.
Müller erfährt erst am 11.5.1836 durch drei Briefe
in Bonn, wo er ja nun einige Monate bereits studiert, davon. Also vom
Tod des Freundes. [Quelle L]
[X]
|
Müller wird zu seinem früh
verstorbenen Freund
Burgmüller als "Dr. M." Anfang 1840 eine Artikelserie in der
"Neuen Zeitschrift für Musik" veröffentlichen. Sein Redakteur
war dabei Robert Schumann.
Müller wird zudem in Düsseldorf
zwölf Jahre später 1850 bis 1853 Arzt für eben diesen
Robert Schumann sein.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1837 |
Jakob
Dielmann
erstellt ein gezeichnetes Portrait von W. M. v. K. – Jakob
Fürchtegott Dielmann (* 9. September 1809 in Frankfurt am Main | +
30. Mai 1885 Frankfurt am Main), deutscher Illustrator, Genre- und
Landschaftsmaler. Das
Bild findet
sich schwarz-weiß gedruckt in Quelle B, Bd. 1, zwischen Seite 160
und 161. [X] Das "Klischee" für den Druck 1959 wurde erstellt bei
Kaiser-Klischees Köln.
|
Das Original des Bildes befindet sich
demnach im Kölnischen Stadtmuseum. [Quelle B, Bd. 1, S. XI]
|
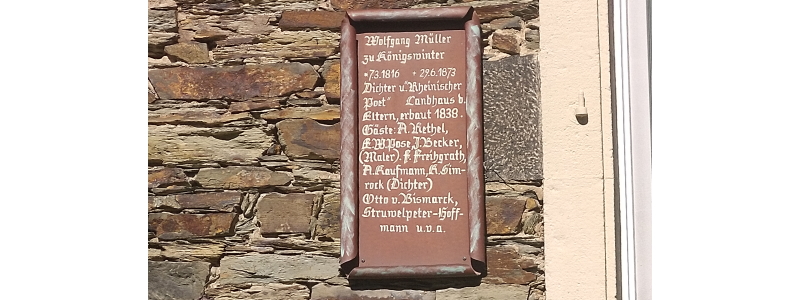
Diese
Gedenktafel findet sich (z. B. am 26.9.2023, Foto K. J.) am damals
(1838) neuerbauten Haus der Eltern von Wolfgang Müller von
Königswinter in (heute) "Bad Bodendorf" an der Ahr, Hauptstr. 138.
(Früher besuchte man in Bodendorf immer Oma Fuchs, Johanna
Walburga Everharda Fuchs, die war aber gestorben am + 9.2.1822 in
Bodendorf. Vermutlich hat es noch weitere Verwandte dort gegeben, von
Müller-Mutter Johanna Catharina Fuchs.) W. M. v. K. war damals,
beim Hausneubau (1838) vielleicht 22 oder 23 Jahre alt. Auf der Tafel
lesen wir: "Wolfgang Müller zu
Königswinter *7.3.1816 (Achtung:
Datum falsch, vielleicht irgendwann mal falsch nachgemalt: am *
5.3.1816 wurde W. M. v. K. geboren, K. J.) + 29.6.1876 Dichter und 'Rheinischer Poet'
Landhaus d. Eltern, erbaut 1838. Gäste A. Rethel, E. W. Pose, J.
Becker (Maler). F. Freiligrath, A. Kaufmann, K. Simrock (Dichter) Otto
v. Bismarck, Struwelpeter-Hoffmann u. v. a." [X] Siehe auch ein
paar Felder weiter unten das Gesamthaus als Foto. ||| Also, es waren
dort: Alfred Rethel (1816–1859) und Jakob Becker (1810–1872) und Eduard
Wilhelm Pose (1812–1878) und Ferdinand Freiligrath (1810–1876) und
Alexander Kaufmann (1817–1893) und Karl Simrock (1802–1876) und Otto
von Bismarck (1815–1898), ja, der berühmte, u. a. erster
Reichskanzler des "Deutschen Reiches" ab 1871, und der Frankfurter Dr.
Heinrich Hoffmann (1809–1894, dessen Struwwelpeter kennen wir heute
eher mit zwei "w") waren allesamt in diesem Haus zu Gast. Etliche davon
brachte Sohn Wolfgang Müller von Königswinter mit, z. B. aus
Düsseldorf, Maler Jakob Becker wurde für die
Müller-Eltern zudem zum Schwiegersohn, und das auch in diesem
Hausbau-Jahr 1838, 1838, wenn man dem Schild am Haus folgt. [X]
|||
This file is licensed under the Attribution-Share
Alike 4.0 International license. (CC BY-SA 4.0) Das von Klaus
Jans gemachte Foto kann also problemlos und leicht unter
Berücksichtung der Hinweise in der hier deutschsprachigen Lizenz
genutzt werden. K. J. Es liegt auch größer noch vor. |||


| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1838 ||| 12.5.1838
|
Hochzeit von W. M. v. K.-Schwester Wally (Walburga) Müller mit dem
Maler Jacob/Jakob Becker in Düsseldorf. [Quelle: Anzeige
des Ehepaares am 14.9.1838 in der "Düsseldorfer Zeitung", siehe
Bildausschnitt der Zeitungsseite direkt hier unten.] [X]
|
Das Ehepaar wird später nach Frankfurt ziehen. Jakob Becker wird
auch eine Städel-Professur (Städel'sches Kunstinstitut)
bekommen. Das Grab des Ehepaares ist auf dem Hauptfriedhof Frankfurt a.
M. [X]
|
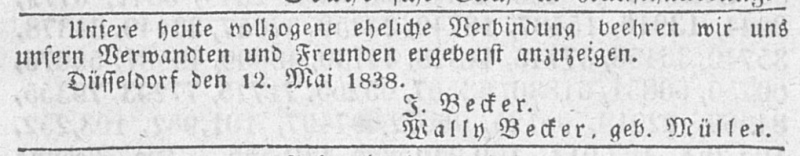
Auf
diesem von K. J. verkleinerten Zeitungsausschnitt aus der
"Düsseldorfer
Zeitung" vom 14.5.1838 sehen wir, dass Wally Müller, die Schwester
des
W. M. v. K., und Jacob/Jakob Becker, der später so bekannte
Maler, am
12.5.1838 in Düsseldorf geheiratet haben. W. M. v. K. selber war
damals
22 Jahre alt. Seine Schwester war zum Hochzeitstag noch 19 Jahre alt.
[X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1838 ||| 7.9.1838 |
Müllers Abreise nach Amsterdam
sollte dann sein. Am 7.9.1838. So zumindest die Planung. Siehe Brief
Müller an Ferdinand Freiligrath am
6.9.1838. [Quelle
B, Bd. 1, Seite 90]
|
Resultat der Reise: 14.9.1838, erster
Besuch des Amsterdamer Hafens. 16.9.1838, Zandvoort. [Quelle B, Bd. 1,
Seite 156] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1838 ||| 14.9.1838 |
Müller in Holland: 14.9.1838,
erster Besuch des Amsterdamer Hafens.
16.9.1838, Zandvoort. [Quelle B, Bd. 1, Seite 156] |
Die Gedichte "Der Ocean liegt still und
gross und hehr" sowie "Ich wandle am gelben Strande" (gedruckt in dem
Buch Junge Lieder
1841) sollen diese Holland-Erfahrungen laut des/dem Biografen Paul
Luchtenberg
verarbeiten.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1838 ||| 15.10.1838 |
Rück-Abreise
des W. M. v. K. aus
Holland [Quelle B, Bd. 1, Seite 95] Am 14.10.1838 hatte er noch
einen
Brief an Freiligrath von Amsterdam aus geschrieben. [Brief abgedruckt
in
Quelle B, Bd. 1, Seite 93 bis 95.] |
Im Herbst 1838 kommt Gottfried Kinkel
nach Bonn. Als Theologe lehrt er an der Universität Bonn. W. M. v.
K. wird ihn und seine (spätere Ehe-Frau) Johanna noch kennenlernen.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1838 ||| 7.11.1838 |
Erst
jetzt ist W. M. v. K. wieder in
Bonn, beim Studium, vorher war er wohl noch in Düsseldorf,
wo Familie Müller wohnte,
einige Tage lang. [Siehe Brief
15.11.1838 an Freiligrath, abgedruckt in Quelle B, Bd. 1, Seite 96/97.]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1838 ||| 2.12.1838 |
W. M.
v. K. sitzt in Bonn, als
Medizinstudent, in Erwartung einer Kaiserschnitt-Operation.
[Siehe
Brief 2.12.1838 an Freiligrath, abgedruckt in Quelle B, Bd. 1, Seite 98
bis 100.] Wir erfahren aus Teil 2 des Briefes, dass die OP gut
verlaufen ist. [X]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1838 ||| 22.11.1838 |
Gesuch des W. M. v. K., sein Militärdienstjahr erst
ab 1. April 1841 ableisten zu dürfen. Das wurde am
12.12.1838 aus
Berlin genehmigt. [Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
1838. Erstes Deutsches Sängerfest
in Frankfurt, Chortreffen, mit
Tausenden Teilnehmern. Forderungen nach deutscher Einheit und
bürgerlichen Freiheitsrechten. |

In diesem Haus,
Hauptstraße 138, Bodendorf/Ahr, heute gehört "Bad Bodendorf"
zu
Sinzig, wohnte die Mutter von W. M. v. K., bis sie zum Ende ihres
Lebens aber noch nach Remagen umzog. Johanna Katharina Müller
hatte den
Sohn überlebt. Der Schriftsteller starb 1873, in Beul/Wadenheim,
heute Bad Neuenahr-Ahrweiler, nicht weit von Bodendorf, seine Mutter
verstarb erst 1886 mit 81 Jahren. Es ist genau das Haus auf dem Bild
diejenige Mini-Villa, die sich die
Arzt-Familie
des Johann Georg Müller, Vater von W. M. v. K. (alle zu der Zeit
in Düsseldorf wohnend), 1838 in
Bodendorf selber als Feriensitz bzw. Stadtflucht erbaute. (Das Foto von
2021 wird hier von K. J. verkleinert wiedergegeben, und zwar mit
freundlicher Genehmigung des Fotografen Anton Simons, siehe
das Original-Bild größer im AHR-WIKI: Direkt-Link.) Es gibt
auch eine Informationstafel an dem Haus. Siehe den Text der Tafel
einige Felder weiter oben in dieser Web-Page hier. [X]
"Das Haus ist nicht allein deswegen
bemerkenswert, weil es deutlich außerhalb des alten Dorfkerns
errichtet worden, zudem sehr gut erhalten und stilistisch in einer
Reihe mit dem jetzigen Pfarrheim und Feys Haus zu sehen ist, sondern
weil die Erbauer die Eltern des später berühmten rheinischen
Dichters Wolfgang Müller von Königswinter gewesen sind, die
durch Erbschaft zunächst Mitbesitzer des Landskroner Zehnthofs
waren." [Zitat aus Dr. Jürgen Haffke, Text "Sinzig-Bad
Bodendorf", Homepage-Stand: 03-Apr-2021, abgerufen am 1.4.2023. Direkt-Link] Weiteres
Zitat daraus: "Dass auf dem Gelände der drei Häuser
Hauptstraße 107, 111 und 113 der Landskroner Zehnthof gestanden
hat, lässt sich nicht mehr unmittelbar erkennen."
Erst Ersteigerung 1802, dann
Weitervererbung 1822, bezüglich des "Zehnthofes" und
bezüglich der Familie Fuchs/Müller. Denn wir
lesen bei >>Die Landmessung von 1792 und andere
Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr. Karl August Seel, Heimatjahrbuch
des Kreises Ahrweiler 1992<<, ab Seite 55 findet sich dieser
Gesamttext, konkret zu dem
Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10: "Dr.
Georg
Müller,
Düsseldorf. Schwiegersohn des Jean Peter Fuchs aus Bonn und Vater
des
seinerzeit berühmten rheinischen Dichters Wolfgang Müller zu
Königswinter. Fuchs ersteigerte 1802 von Freiherr vom Stein den
Landskroner Zehnthof in Bodendorf (Hauptstraße 109, 111, 113).
Das Haus
Hauptstraße 138 wurde später von Müller als
Feriendomizil (um 1835)
erbaut. Dort ist der abgebildete Stein aufgestellt, zwei weitere sind
bekannt." -- K. J. fragt: Was wurde aus dem Zehnthof?
Verkauft? Abgerissen? Und: wieso? Was bewog den Arzt Johann Georg
Müller und seine Frau Johanna Katharina, geb. Fuchs, also die
Eltern
des W. M. v. K., dazu, sich von diesem "Landskroner Zehnthof" in
Bodendorf zu trennen und zugleich ein Haus neu zu bauen? [Die
Versteigerung des Landskroner Zehnthofes im Jahr 1802 aus dem Besitz
des
Freiherrn vom Stein an den Bonner Johann (Jean) Peter Fuchs, Vater von
W. M. v. K. Mutter Johanna Catharina Fuchs, hat auch
der Leiter des Heimatarchivs Bodendorf, Herr Josef Erhardt, dem Autor
dieser
tabellarischen W. M. v. K.-Biografie am 3.4.2023 bestätigt. |||
Vorbesitzer des Landskroner Zehnthofes war also Heinrich Friedrich Karl
Reichsfreiherr vom und zum Stein (* 25. Oktober
1757 in Nassau, Herrschaft Stein zu Nassau | + 29. Juni 1831 in
Cappenberg, Provinz Westfalen, Königreich Preußen, so laut
Quelle W.]
1839 ||| 3.1.1839 Gründung der Dresdner
Liedertafel
(erstes
öffentliches Singen dieses Chores aber erst am 12.11.1840)
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1839 ||| 16.3.1839 |
Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s Abgangszeugnis
der Universität Bonn.
[Quelle B, Bd. 2, S. 487]
Der Abschied von Bonn fällt jedoch schwer: Er schreibt an
Freiligrath am 28.3.1839 rückblickend: »Mein Herz ist so
recht mit der ganzen Gegend verwachsen, meine freiesten Gedanken habe
ich auf diesen Bergen gedacht, meine glühendsten Lieder habe ich
in diesen Thälern gesungen, und Städten [...]« [Zitiert
nach Quelle B, Bd. 1, S. 104]
|
1839 in Mainz ||| Beginn des
Männerchores, die Liedertafel gab
es schon seit 1831. |
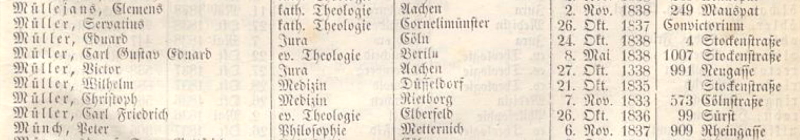
Wir
sehen in der Liste
(AUSSCHNITT) Wilhelm
Müller (der sich später als Poet und Schriftsteller "Wolfgang Müller von
Königswinter"
nennen sollte), hier letztmals als Student auftauchen in "Amtliches
Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der
Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Bonn für das
Winter-Halbjahr 1838–1839". Er studiert Medizin, wohnt immer noch
(Herkunft/Hauptwohnsitz) in Düsseldorf, er hatte sich früher
mal am
21.10.1835
immatrikuliert. Seine aktuelle (und vermutlich letzte) Wohnung in Bonn
ist "1 Stockenstraße". [X] Das wäre vielleicht der
Straßenzug direkt an der
Uni-Schloss-/Schloßkirche, also fast direkt am Hauptgebäude
(ehemals ein Schloss) der Universität, und die Häuserzeile
direkt hinter dem
Stockentor, wenn man heute von
Richtung Bad Godesberg kommt. Man sehe hier den Kartenausschnitt
über den Open-Street-Map-Direkt-Link
für die Stockenstraße in Bonn heute. – Am
1.11.1835 war W. M. v. K. von Bodendorf (Ahr), wo ja eine Art
Müller-Fuchs-Familien-Stammsitz und zugleich Feriensitz war,
zusätzlich zum
Hauptwohnort
Düsseldorf, nach Bonn zum eigentlichen, realen Studienbeginn
gekommen. [X]
Immatrikulation bei Müller, damals noch als Wilhelm Müller,
bereits 21.10.1835. Studium-Ende in
Bonn Mitte März 1839. [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1839 ||| 2.4.1839 |
Beginn des Kölner Kunstvereins, W.
M.
v. K. wird Jahre
später in Köln wohnen, ab 1853, und auch aktiv im Kunstverein
sein. U. a. jahrelang als Sekretär. Siehe dazu auch weiter unten
auf dieser Web-Page. [X]
|
In Köln: 2.4.1839 und dazu die
Genehmigung
am 7.4.1839 =
Gründung des Kölner Kunstvereins. 1. Präsident Everhard
von Groote. Sitz in der Trankgasse 7. [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1839 ||| Februar |
W. M.
v. K. war vermutlich zu Carneval
in Köln, bei Freund Matzerath. [Siehe Brief 13.1.1839 an
Freiligrath, abgedruckt in Quelle B, Bd. 1, Seite 101/102.]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1839 ||| 19.4.1839 |
Vermutlicher
Tag der Abreise des W. M. v. K. nach Berlin, es sollte bewusst
eine langsame Reise sein, mit oftmaligem Haltmachen.
Siehe Brief Müller an Ferdinand Freiligrath am 11.4.1839
[abgedruckt in Quelle B, Bd. 1, Seite 105]. [X]
|
Müller wird in Berlin sein
Medizinstudium fortsetzen, welches er vom Herbst 1835 bis März
1839 in Bonn betrieben hatte.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1840 |
Gustav
Blaeser erstellt ein Portrait von W. M. v. K. als Relief in Form
einer Medaille – Gustav Hermann Blaeser (auch Bläser) (* 9. Mai
1813 in Düsseldorf | + 20. April 1874 in Cannstatt). deutscher
Bildhauer. – Ein
Foto-Bild des Reliefs findet
sich schwarz-weiß gedruckt in Quelle B, Bd. 1, zwischen Seite 208
und 209. [X] "Klischee" für den Druck 1959 wurde erstellt bei
Kaiser-Klischees Köln.
|
Das Original des Bildes befindet sich
demnach im Heimatmuseum Köngiswinter. [Quelle B, Bd. 1, S. XI]
Heute heißt es Siebengebirgsmuseum. – Blaeser wird später
auch das Reiterstandbild Friedrich Wilhelm IV. an der
Hohenzollernbrücke, Einweihung 1867, in Köln gestalten.
Müller wohnt nun auch in Köln und ist dort in der Kunst- und
Kulturpolitik tätig.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1840 ||| 23. April 1840 |
* Geburt
der Müller-Nichte Marie ((und eher nicht: Maria mit a))
Becker
am *
23.4.1840.
Laut dieser [W]-Quelle "Briefe von
Marie, Herbert und Wilhelm von Bismarck (Kinder von Otto und Johanna
von Bismarck) an Marie Meister heute in: GStA PK, VI. HA, FA Bismarck,
v., Nr. 1." hieß sie (Geburtsname) "Marie Georgine
Arnoldine Becker" (* 23. April 1840 in Düsseldorf). Sie
wird den
Hoechst-Mitbegründer Carl Friedrich Wilhelm Meister am 3.9.1861
heiraten und am
+
21.7.1912 (laut Grabstein) [X] versterben.
Ihr Grab ist im Familiengrab C. F. Wilhelm Meister
auf dem
Hauptfriedhof Frankfurt a. M.
[ Siehe zu diesem C. F. W. Meister u. a.
https://frankfurter-personenlexikon.de/node/482 oder Deutsche
Biographie et al.. – Wichtige Informationen lassen sich offenbar in
dieser Ur-Quelle finden: Karl Wilhelm von Meister, Nachrichten zur
Geschichte
der Familie Meister, 1904, S. 88-101. Das Buch wurde (laut den
"Chronikblättern" für die Familie Luyken, hier Jahrgang 1935,
S. 326 ff.) am 1. Oktober 1904 abgeschlossen und ist als Manuskript
durch Adam Etienne zu Oestrich im Rheingau gedruckt. [X] Das Werk zur
Familiengeschichte hat der Sohn des C. F. W. Meister, also: Karl
Wilhelm von Meister, ehemals Regierungspräsident, verfasst. ]
|
Es
sind zwei Töchter der
Müller-Schwester Wally, also zwei W. M. v. K.-Nichten, die jeweils
einen der Mit-(Be)Gründer der
später so bekannten Farbwerke Hoechst AG, dann auch mal
Unternehmens-Teil der aktiv
in NS-Verbrechen verwickelte(n) I. G.
Farben, heiraten. 1)
Maria/Marie Becker heiratet 1861 in Frankfurt C. F. Wilhelm Meister
2) Schwester
Maximiliane Eduarde Becker heiratet bereits 1860 Eugen Lucius.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1840 ||| 7.6.1840 |
In Berlin: W. M. v. K. erlebt (noch)
vor Ort in Berlin den
Todestag des Königs Friedrich Wilhelm III. am 7.6.1840. |
Friedrich Wilhelm IV. (* 15.
Oktober 1795 in Berlin | + 2. Januar
1861 in Potsdam) wurde dann der neue König. Er war vom 7. Juni
1840 bis zu seinem Tod 1861 der König von Preußen.
Müller wird noch den nächsten Wilhelm zu Lebzeiten mitmachen,
den späteren deustchen Kaiser. Dessen Ehefrau Augusta wird (da
noch als Prinzessin) bei der Quellenweihe 1858 in Neuenahr (Wadenheim)
anwesend sein, wofür Müller wiederum ein Festgedicht schrieb.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1840 ||| 16. Juli 1840 |
Müller kehrt so langsam nach
Düsseldorf zurück. Abschied
von Berlin ist jedenfalls
am 16. Juli 1840.
Quelle: Brief an Thomas Arens, 16.9.1840, abgedruckt in: [Quelle B, Bd.
1, Seite 144] Wilhelm Herbertz begleitet ihn. Die Heimreise wird sich
aber über einen Monat erstrecken, weil es eine Reise mit
Zwischenstationen ist.
|
_ |
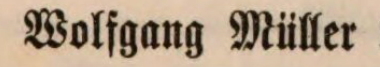
1841
veröffentlicht er als (Künstlername) Wolfgang
Müller, nicht mehr als Carl/Karl Wilhelm Müller oder Wilhelm
Müller.
Allerdings noch ohne den Zusatz "von Königswinter", der wird erst
circa 5 Jahre später auftauchen, auf Druckerzeugnissen.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1841 | Karneval 1841, vermutlich Februar |
W. M.
v. K. lernt zu Carneval in Köln die Emilie Schnitzler kennen
(erstmals, der Kontakt vertieft sich über die Jahre dann).
ZITAT: "Als ich auch Carneval 1841 in
Köln war, führte Georg Jung mich in das Haus, wo ich die
freundliche Blondine, welche eben erst aus einer Brüsseler Pension
gekommen war, zuerst sah. Sie machte sofort einen überaus
anmuthigen Eindruck auf mich."
|
Das Zitat stammt offenbar aus den
handschriftlichen Aufzeichnungen im Müller-Nachlass. Luchtenberg
hat sehr viel von diesem Material eingesehen und es zudem für die
Nachwelt gesichert. [Zitat links nach Quelle B, Bd, 1, Seite 233]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1841 ||| 23.2.1841 |
Müller
publiziert ein einziges Mal in der heute berühmten Bonner
Zeitschrift "Maikäfer", und zwar das Gedicht "Bürgerlied",
das in Jahrgang 2, Nr. 8, vom 23. Februar 1841 steht.
KURIOSUM: Die Zeitschrift existierte offenbar jeweils nur als ein (1!)
Exemplar. [Siehe bei W.]
Müller studierte bereits ab Herbst 1839 in Berlin, in Bonn war er
vom Herbst 1836 bis Frühjahr 1839 an der Universität. Er
studierte Medizin, lernte auch Kinkel sowie Johanna kennen. (Siehe dazu
weiter oben hier in dieser Tabellen-Chronik.) Als W. M. v. K. nach
Berlin wechselte, war der Maikäferbund noch nicht gegründet.
Als Müller aus Berlin 1840 zurückkam, lebte er wieder in
Düsseldorf und praktizierte dort als Arzt.
Laut den Infos bei [W] war Karl Simrock ("Redlich") ein normales
Mitglied im Maikäferbund, und es gab u. a. diese folgenden drei Ehrenmitglieder, insgesamt waren es
fünf, auch wieder mit
extra Maikäferbund-Namen: 1) Ferdinand Freiligrath
("Wüstenkönig", "Alligator") 2) Christian Joseph Matzerath
("Morgenröte"). 3) Wolfgang
Müller von Königswinter ("Gewitteranschieber"). |||
Müller kannte Simrock und Freiligrath und Matzerath seinerseits
sehr gut. Sie waren befreundet. Man erinnere sich allein an
"Rheinisches Jahrbuch für Kunst und Poesie" (zwei Ausgaben: 1840
und
1841) sowie an Müllers Widmung in seiner ersten eigenen
Monographie: "Junge Lieder" (1841).
|
Herzlichen Dank für diesen exakten
Quellen-Hinweis an den Heimatverein Bonn-Oberkassel. ||| Der
Maikäferbund
war eine literarische Gruppe. Diese existierte von Sommer 1840 bis
März 1847. Gegründet wurde der Maikäferbund in Bonn am
29. Juni 1840 von Sebastian Longard, Andreas Simons sowie Johanna
Matthieux (geboren wurde sie als Mockel, später nach Scheidung und
Heirat II. heißt sie bekanntlich Johanna Kinkel, K. J.) und
Gottfried
Kinkel. [Quelle: W, Wikipedia beruft sich seinerseits auf
unterschiedliche Quellen und Publikationen.] Bedeutsam zuallererst der
Maikäfer-Nachdruck: Ulrike
Brandt-Schwarze (Hrsg.): Der Maikäfer: Zeitschrift für
Nichtphilister. Röhrscheid, Bonn 1982ff., Reprint in der Reihe
"Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bonn", hier: die
Reihen-Bände 30 bis 33, = Bd.
30: Bd. 1, Jg. 1840 und 1841 / 1982 / 850 S. ||| Bd. 31: Bd. 2,
Jg. 1842 und 1843 / 1983 / 651 S. ||| Bd. 32: Bd. 3, Jg. 1843 und 1844
/ 1984 / 639 S. ||| Bd. 33: Bd. 4, Jg. 1845 und 1846 / 1985 / 582 S.
||| Laut schriftlicher Auskunft von Prof. Hermann Rösch an K. J.
findet
sich das
Müller-Gedicht in Band 1, S. 347, dieser Stadt-Archiv-Publikation.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1841 März / Frühjahr |
JUNGE
LIEDER – Das erste "eigene"
(monographische) Buch
des W. M. v. K. erscheint in
Düsseldorf, Verlag J. H. C. Schreiner, als Autorenname
zudem "Wolfgang Müller", also ein Künstlername. Ein (halbes)
Pseudonym. Er ist jetzt 25 Jahre
alt.
Geboren wurde er, W. M. v. K., am 5.3.1816 als
Peter Wilhelm Carl/Karl Müller, Rufname war immer Wilhelm.
Eine
Mini-Ankündigung, 1 Zeile, zu "Junge Lieder" findet sich im
Börsenblatt
für den Deutschen Buchhandel,
Ausgabe 4.5.1841, Nr. 37, Seite,
halt: Spalte!, diese (rechte) Spalte ist nummeriert als 901. Unter
etlichen
Büchern im "Verzeichnis der im deutschen Buchhandel erschienen
Neuigkeiten, angekommen in Leipzig
vom 25. April bis 1. Mai 1841" vermerkt. [X]
|
Er wird das
noch unfertige Buch als "Aushängbogen", siehe dazu Brief von W. M.
v. K, 17. März 1841, an Johanna Mathieux (später nach
Scheidung und Neu-Hochzeit ⚭ 22.5.1843 Johanna
Kinkel heißend) verschicken. (Das Buch war auch oder vor allem
für Gottfried Kinkel
bestimmt.) Auszug aus dem Brieftext::
"Hoffentlich werden die
Büchlein nächste Woche fertig." [Quelle B, Bd. 1, S.
159.] |
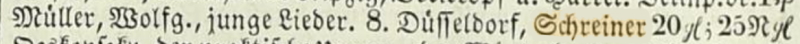
Nur
1 Zeile im Börsenblatt 4-5-1841
||| Die 8 steht vermutlich für 8 Oktav = Oktavformat, eine
Größenangabe,
1 Rohbogen, 3 x gefaltet, ergibt 8 Papier-Blatt-Seiten (= 16
Druckseiten), die Bogengröße war nicht normiert. |||
Schreiner ist der Verlag, die orangefarbene Einfärbung entspricht
NICHT
dem Original.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1841 ||| 30.7.1841 |
W. M. v. K.s
Rheinlied-Text "Mein Herz ist
am Rheine" (Lied 30 aus dem Buch "Junge Lieder") wird einzeln
(ab)gedruckt. |
"Mein Herz ist
am Rheine" (Lied 30 aus dem Buch "Junge Lieder") wird in der
Zeitschrift "Didaskalia", einer belletristischen Beilage zum
Frankfurter
Journal, abgedruckt: Didaskalia. 1841,7/9 = Jg. 19 | 30.07.1841
(Heidelberg/Frankfurt) [X] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1841 ||| 31.8.1841 |
Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s Entlassungs-Attest
aus dem Militärdienst. Ausgestellt in Berlin.
[Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
_
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1841 |
Sieben
Gedichte von
Wolfgang Müller erscheinen in einem Buch,
erneut nun unter dem neuen Künstler(vor)namen
Wolfgang. |
7 Gedichte von
"Wolfgang Müller" erscheinen in "Rheinisches Jahrbuch für
Kunst und Poesie", hier
das 2. Buch, also der 2. Jahrgang (danach war bereits Schluss dieses
Jahrbuch-Projektes),
herausgegeben von F. Freiligrath, C. Matzerath und K. Simrock (diesen
drei
Freunden hatte W. M. v. K. sein eigenes Werk "Junge Lieder" vorne im
Junge-Lieder-Buch groß gewidmet) ||| Ausgabe 2.1841 (ab Seite 382
finden
sich die Müller-Gedichte in diesem zweiten Rheinischen Jahrbuch).
[X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1841 ||| 14.11.1841 |
Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s Approbation
als Geburtshelfer.
(Ausgestellt in Berlin.)
[Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
_
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1841 ||| Dezember 1841
|
"Der praktische Arzt und Wundarzt Dr.
Carl Wilhelm Müller zu Düsseldorf ist als
Geburtshelfer
approbirt und vereidigt worden." Das meldet das
"Düsseldorfer
Kreisblatt und Täglicher Anzeiger" vom 27.12.1841 auf Seite 1 in
der "Personal-Chronik". [X] Carl Wilhelm ist er hier, als Arzt – als
Autor ist er aber bereits Wolfgang Müller.
|
Das Buch "Balladen und Romanzen", W. M.
v. K.s zweites eigenes Buch, wird schon im Dezember 1841 gedruckt.
[Quelle
B, Bd. 1, S. 183] Das Buch hat 188 Seiten, ist also deutlich
umfangreicher als "Junge Lieder". Eine Ballade ist per se als Textsorte
üblicherweise eher länger.
|
Im Adressbuch "Grosses
Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten und handelnden Gewerbsleute von
Europa und den Hauptpläzen der fremden Welttheile. Zugleich
Handelsgeographie, Produkten- und Fabrikaten-Bezugsangabe. BAND 4,
Rheinpreußen und Westphalen,
Nürnberg, Verlag von C. Leuchs und Co., 1842" lassen sich die
erfassten Buchdruckereien finden, für Düsseldorf: "Stahl,
Lorenz" und "Wolf, Jos.", siehe Seite 266. [X] Weitere Angaben finden
sich nicht, auch keine Straße et al. [X] "Arnz & Comp." als
"Lithographische Anstalt" ist extra und ohne Rubrik an anderer Stelle
erfasst. Im selben Adressbuch finden sich auf Seite 267 auch die
(für 1842 bzw. für das 1842 veröffentlichte Buch
erfassten Buchhändler) für Düsseldorf: "Beyer &
Comp., G. H.", "Forberg.", "Schaub, J. E.", "Schreiner, J. H. E.",
"Stahl, Jos." [X] Eine Eintragsrubrik "Verlag" war in diesem Buch nicht
zu finden. [X] Wir wissen also, welche Optionen Müller um
1841/1842 in Düsseldorf überhaupt zur Verfügung standen,
um etwas zu veröffentlichen.
Hinweis:
Man liest hier eher "J. H. E. Schreiner", aber der Verlag (bzw. die
Verlagshandlung und Buchhandlung) ist eigentlich als "J. H. C.
Schreiner" bekannt. [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND Was ringsum
passierte
|
| 1842 ||| 1.1.1842 |
Wolfgang Müllers Gedicht "Die
Harrende" wird gedruckt. |
In der
"Hamburger Neue Mode-Zeitung" (Revue für Theater, Literatur,
Musik, Kunst und Mode) "Redigirt von Ludwig Lenz", Verleger ist Robert
Kittler, Hamburg; es ist erste Ausgabe überhaupt, Nr. 1. Darin
erscheint unter dem Namen
"Wolfgang Müller" das Gedicht "Die Harrende". [X] Kittler hatte
zumindest seine Buch- und Kunsthandlung erst am 2.5.1840 gegründet. |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND Was ringsum
passierte
|
| 1842 ||| 1.1.1842 ff. |
Müller
wird (spätestens ab April) im
Jahr 1842 in der "Rheinischen Zeitung" publizieren (in diversen
Ausgaben, z. B. Nr.
108, diese vielleicht am 20. April 1842 erschienen), 15 Kalenderwochen
plus 3 Tage. (Hinweis K. J. zur obigen Zeitberechnung,
-schätzung:: Die Ausgabe Nro. 289 erschien sicher mit Datum
16.10.1842. Das war ein Sonntag. 41 Kalenderwochen plus 2 Tage = 289
Tage.)
|
Am 1.1.1842 erscheint die "Rheinische
Zeitung für Politik,
Handel
und
Gewerbe", kurz "Rheinische Zeitung". W. M. v. K. wird darin
publizieren. (Zumindest: "Laienbriefe
über die bildende Kunst" in Frankreich, Artikelserie, in
den Ausgaben mit den Nummern 108, 110, 117, 118, 139, 141.) [Quelle B,
Bd 1,
S. 181] u. [Quelle B,
Bd. 2, S. 441] ||| Karl Marx
sollte im Oktober 1842 die Redaktionsleitung übernehmen. Aber alle
(?)
Artikel blieben offenbar anonym, es gab also keine Autorennamen.
[Quelle W]
(HINWEIS: K. J. fand aber eine RZ-Seite, wo Autorennamen zu finden
waren.)
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1842 ||| 9.1.1842 |
Beginn
der Reise des W. M. v. K. nach
Frankreich ab 9.1.1842. [Quelle B, Bd. 1, S. 167] Es geht via
Köln
mit dem Zug nach Aachen, mit der Postkutsche nach Lüttich, mit dem
Zug weiter nach Antwerpen, wo der Bruder des Vaters (W. M. v. K.s
Onkel) Peter Wilhelm Müller wohnt. Weiter nach Brüssel,
weiter via Postkutsche und Zug nach Paris. ||| Zufälliges
Zusammentreffen mit Heinrich Heine am 1.4.1842.
|
1842, im Januar 1842 bereits!
Müller
war aber schon im Januar beim Erscheinen dieses zweiten
Müller-Komplett-Buches in Paris. [Quelle B, Bd 1., S.
183]
Es erscheint nun das zweite eigene
Buch des
W. M. v. K.in
Düsseldorf, wieder beim Verlag J. H. C. Schreiner: "Balladen und
Romanzen". Aufgedruckter Autor ist erneut Wolfgang Müller, also
der Künstlername, nicht Wilhelm Müller.
188 Seiten. |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1842 ||| noch
vor Pfingsten, Mai 1842
|
1842 vor Pfingsten (Hinweis: 15.5. war
Sonntag, 16.5. war der Pfingstmontag): W.
M. v. K. trifft wieder in
Düsseldorf ein.
[Quelle B, Bd. 1, S. 183] |
27.4.1842 Gründungsversammlung des
Kölner Männer-Gesang-Vereins.Heute noch sehr aktiv, und sehr
bekannt in Köln und anderswo, kurz als KGMV. Stichwort:
Haus Wolkenburg (Mauritiussteinweg 59), Stichwort: Divertissementchen.
Dieser Gesang-Verein / Gesangverein / Gesangsverein bzw. Chor,
wird am 29.6.1896
(!!!) bei der Denkmals-Enthüllung (für W. M. v. K. ist das
Denkmal) in
Königswinter vor Ort singen. (Siehe weiter unten bei 29.6.1896 ein
JPG-Bild des Festprogramms! Müller sollte ab 1853 fest in
Köln wohnen.) [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1842 ||| 11.7.1842 |
Müller
bekommt eine Buchbesprechung. In: "Deutsche Jahrbücher für
Wissenschaft und Kunst", Redaktion nun in Dresden. [X]
In einer Ausgabe vom Juli 1842, 11.7.1842, Nro. 163, werden
tatsächlich Müllers Bücher "Junge Lieder" und, vor
allem, "Balladen
und Romanzen" durch "E. M." in einem Artikel besprochen, Seite
651 und 652. [X]
Müller hatte am 8.4.1841 (da noch unter anderem Namen: "Hallische
Jahrbücher [...]") und ein Jahr später erneut, am 8.4.1842,
den Redakteur und Herausgeber Arnold Ruge angeschrieben. Verleger war
Otto Wigand in Leipzig, Druck bei Breitkopf & Härtel, Leipzig. |
Zitat aus der Buchbesprechung: "In seinen 'jungen Liedern' hatte er sich
uns als muntren, kecken Rheilandssohn dargestellt, dem das Lied so
frisch aus der Kehle strömt, wie dem Vogel sein Gesang. Und der
sein Heimathland gern so herzig und freiheitslustig besingen
möchte, wie Robert Burns, sein Lieblingspoet, Schottland besang."
[X] (S. 632 oben) Dem Verfasser E. M. kommt aber das zweite
Müller-Buch, das Balladenbuch, nun "antiquirt" vor. [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1842 ||| 22.9.1842 |
+ Tod
des Vaters von W. M. v. K. ||| + Johann
Georg
Müller + 22. September 1842
in Düsseldorf (* 24.9.1780 in
Mülheim
am Rhein). Alter des Vaters: 62 Jahre.
Genauer Sterbeort
laut Sterbeurkunde: Grabenstraße 788. [Quelle D] [Siehe auch die
Todesanzeige in der Düsseldorfer Zeitung, 25.9.1842, da steht
allerdings
keine
Adresse ... und im Übrigen auch kein Hinweis auf die Beisetzung.]
[X]
Es gibt auch einen (katholischen) Totenzettel, Pfarrgemeinde zum h.
Maximilian, (heute oft kurz: Maxkirche), StA Düsseldorf,
Totenzettelsammlung 7-0-2. [Auch als Abbildung 23 in Quelle D.]
Demnach gab es eine siebzehntägige Krankheit. Der Tod war
ruhig und sanft. Eigenschaften laut Totenzettel: a)
unermüdlicher Eifer b) unwandelbare Menschenfreundlichkeit c)
Wahrheit d) Redlichkeit e) ächt religiöse Gesinnung. [X,
Buchstaben-Reihung auch von X. "ächt" meint in heutiger Schreibung
"echt".]
Die Kirche St. Maximilian befindet sich in der Schulstraße 11–15
/ Citadellstraße 2 in der Düsseldorfer Karlstadt. Diese
Kirchengemeinde war offenbar die
Kirche der Müller-Familie. ||| Seihe Bild-Quelle: Wikimedia
Commons,
hier der Direkt-Link zu einem
Foto von St. Maximilian.
Zur Sterbeurkunde siehe auch: LAV NRW PSA Brühl (mittlerweile ist
die Abteilung
Rheinland des Landesarchivs umgezogen nach Duisburg, Besuchsadresse:
Schifferstraße 30, 47059 Duisburg), die Sterbeurkunde
Düsseldorf Nr. 748/1842, als Faksimile ist aber schon mal
abgedruckt in Quelle D,
Abbildung 22. [X] Siehe auch die Foto-Abbildung der Urkunde bei [W].
|
Zitat aus dem Anzeigentext: "Er
entschlief heute Abend um 8 Uhr, im 62. Jahre seines Alters und im 28.
seiner glücklichen Ehe sanft und ruhig dem Herrn." [X]
In der
Anzeige
stehen als Angehörige die Witwe Johanna geb. Fuchs, Dr. W. (= W.
M. v. K.), Eduard, August (zusammen die 3 Söhne), Wally (die
Tochter) und Prof. J. Becker (der Schwiegersohn Jakob, Angaben in
runden Klammern jeweils erläuternd von K. J.) [X]
Von den einst sieben Geschwistern
(Kindern) des Dr. Johann Georg Müller leben schon seit den Jahren
in Bergheim nur noch vier. [X] Auch der Totenzettel (siehe links)
erwähnt (nur noch) vier Kinder. [X]
Interessant ist genau diese "Maxkirche" auch für den Bezug von W.
M. v. K. zur Musik. Wieso? 1818 wurde der
Städtische Musikverein
zu Düsseldorf gegründet, der ab sofort auch für die
Kirchenmusik in der Maxkirche beim Hochamt, bei Vespern und
außerliturgischen Feiern verantwortlich
zeichnete. So kam es,
dass der jeweilige Leiter des Städtischen Musikvereins auch die
Kirchenmusik in der Maxkirche leitete. Die
Leiter der Kirchenmusik Maxkirche waren somit z. B.:
* 1818 bis 1830 Johann August Franz Burgmüller
* 1833 bis 1836 Felix Mendelssohn Bartholdy
* 1836 bis 1847 Julius Rietz
* 1847 bis 1850 Ferdinand Hiller
* 1850 bis 1854 Robert Schumann.
[Quelle:
www.orgel-information.de/
Orgeln/d/du-dz/duesseldorf_st_maximilian.html
am 5.4.2023 abgerufen] [URQUELLEN ABER OFFENBAR: Schumanns rheinische
Jahre, Droste-Verlag
Düsseldorf 1981
Archiv des Robert-Schumann-Hauses Zwickau Wilhelm Sauer: “Die
Kirchenmusik in der Kirche zum hl. Maximilian von 1818 bis 1862/65 und
der Städtische Musikverein Düsseldorf“ in: „Monatshefte
für katholische Kirchenmusik“, November 1928.] [X]
|
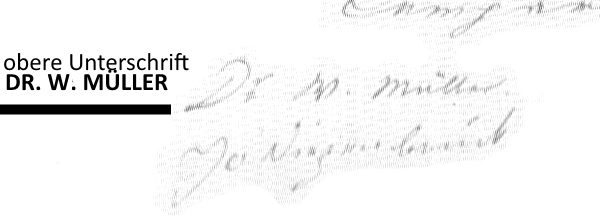
Unterschrift
des Dr. W. Müller (also des W. M. v. K.) unter der Sterbeurkunde
zu seinem Vater Johann Georg Müller. Urkunde 748/1842.
Der Vater starb am + 22.9.1842 in Düsseldorf, Müller
übernahm dessen Arzt-Praxis ... vermutlich so lange, bis die
Familie des Wolfgang Müller / Wilhelm Müller 1853 nach
Köln übersiedelte. Dort war W. M. v. K. noch eine Zeit lang
Arzt, aber de facto wohl zuallererst Schriftsteller.

Die
(spät)barocke "Maxkirche", also St. Maximilian, in
Düsseldorf im November 2009 fotografiert.
Das Gebäude steht im Bereich
Schulstraße/Maxplatz/Citadellstraße (gehört wohl noch
zur "Carlstadt" von Düsseldorf), Hauptportal in der
Schulstraße. Diese Kirche war
offenbar die Kirche und die
kath. Kirchengemeinde für die
Arzt-Familie Müller in Düsseldorf. Zumindest wurden hier die
drei "Seelenmessen" gehalten, für Johann Georg
Müller, Vater des W. M. v. K., im Jahr 1842, am 26. und 27.
und 28.9.1842. ||| Die Leiter
bzw. Verantwortlichen für die
Kirchenmusik in eben dieser Maxkirche waren qua Amt, nämlich
Leitung des Städtischen Musikvereins in Düsseldorf: 1818 bis
1830 Johann August
Franz Burgmüller (Vater von W. M. v. K.-Freund Norbert
Burgmüller), 1833 bis 1836 Felix Mendelssohn Bartholdy, 1836 bis
1847 Julius Rietz (Rietz wird W. M. v. K.-Texte vertonen), 1847 bis
1850 Ferdinand Hiller (Hiller wird W. M. v. K.-Texte vertonen), 1850
bis 1854 Robert Schumann. (W. M. v. K. wird für Schumann eine
Artikelserie über Norbert Burgmüller anlässlich dessen
frühen Todes schreiben und W. M. v. K. wird zudem noch bis 1853
Arzt der Schumann-Familie in Düsseldorf sein.) Also etliche
Müller-Bezüge zur Musik allein schon über diese eine
Kirche. ||| Bild-Quelle: Wikimedia Commons, hier der Direkt-Link zum Foto.
||| Und zudem noch: der Open-Street-Map-Direkt-Link,
fotografiert wurde hier offenbar aus der Hafenstraße, Richtung
Süd(westen): Die Kamera stand nämlich bei Latitude 51.223706
/ Longitude 6.771656 (hier WGS84 in Angabe als Dezimalgrad).
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1842 ||| 28.9.1842 |
28.9.1842, Stichtag zur Anzeige, Datum
steht unten im Text der Anzeige des W. Müller (also hier gedacht
wohl als Wilhelm
Müller alias W. M. v. K.) in der Düsseldorfer Zeitung vom
5.10.1842, erscheint auch erneut am 8.10.1842: "Ich habe mich hier
niedergelassen und wohne Grabenstraße Nr. 791 (im Hause der
Luisenschule.) Düsseldorf den 28. Septbr 1842. W
Müller,
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer." [X]
|
W. M. v. K. übernimmt also
vermutlich die Praxis seines Vaters Johann Geogr Müller nach
dessen Tod + am 22.9.1982.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1843 ||| 1.4.1843 |
_ |
Am 1.4.1843
erfolgt
das Verbot der Rheinischen Zeitung durch die
preußische Zensur. W. M. v. K. hatte darin publiziert,
heißt es. Es gab aber noch einer andere "Rheinische Zeitung",
circa zwei Jahrzenhte später. Da muss man noch genau hinschauen.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1844 |
Müllers Verein, Müllers
Carnevalsverein (er ist Mitglied, aber seit wann genau?) wird nun sogar
aufgelöst. ||| [Zu Müller und AVDK bzw. AVdC siehe kleine
Hinweise in Quelle M.]
|
Verbot von "Allgemeiner Verein der
Carnevals-Freunde". Seit seiner Gründung wurde der Verein von den
Behörden aus politischen Gründen mehrmals verboten. 1844
ließ der Regierungspräsident Düsseldorf Adolph von
Spiegel-Borlinghausen den Verein sogar auflösen. [ Quelle
W, aber
Wikipedia beruft sich hier seinerseits auch auf avdk-duesseldorf.de
] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1845 |
W. M. v. K. ist mit 4
Gedichten in "Deutsches
Bürgerbuch für 1845", Verlag C. W. Leske, 1845,
Darmstadt vertreten. [X] |
Herausgeber ist laut Titelblatt H. (H.
ist Heinrich, K. J.)
Püttmann. Der Band wurde aber direkt von
der preußischen Zensur beschlagnahmt. [Quelle W] – Im zweiten
Buch 1846,
dann erschienen in Mannheim, ist W. M. v. K. aber nicht mehr vertreten,
zumindest laut den publizierten Namen. [X] Die W. M. v. K.-Gedichte im
1. Band sind "Philister über uns!",
Seite 341, "Ich werd ein gottesselger Mann", Seite 342,
"Gemein", Seite 344, "An der Lorelei", Seite 345. [X] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1845 ||| 12.2.1845 |
Ausstellungsdatum von einem Zeugnis für W. M. v. K.
über dessen Tätigkeit als Armen- und Waisenarzt in
Düsseldorf.
(Wurde auch ausgestellt in Düsseldorf.)
[Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1845 ||| 15. Februar
1845
und April 1845
und Mai 1845
|
Friedrich Engels erwähnt W. M. v.
K.als
Teilnehmer einer kommunistischen Versammlung in Elberfeld. Der
Text wurde offenbar geschrieben um den 5.4.1845 herum, abgedruckt dann
in
"The New Moral World" Nr.
46 vom 10. Mai 1845. In einem von insgesamt drei Briefen für die
Zeitung, die den Obertitel
"Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland" tragen. [Quelle:
Marx/Engels, Werke, Berlin, 1972, Band 2] AUSZUG,
Zitat: "Die Diskussion, an der sich auf seiten der Kommunisten
einige Herren Juristen beteiligten, die zu diesem Zweck aus Köln
und Düsseldorf gekommen waren, war wieder sehr angeregt und wurde
bis nach Mitternacht ausgedehnt. Es
wurden auch einige kommunistische
Gedichte des Herrn Dr. Müller aus Düsseldorf, der anwesend
war, vorgetragen." [Quelle für das Zitat:
Marx/Engels, Werke, Berlin, 1972, Band 2, S. 517.] [X] |
HINWEIS: Zum 8., 15. und 22. Februar
1845 beantragte der Maler Gustav Adolf Koettgen beim
Oberbürgermeister von Elberfeld, Johann Adolf von Carnap,
Versammlungen im „Zweibrücker Hof“. Also wäre Müller am
15.2.1845 (bei der zweiten Versammlung) dabeigewesen. [Quelle W]
[Ur-Quelle aber offenbar: Brief Koettgen an Carnap vom 8.2.1845] [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1845 ||| 1.5.1845 |
Zwei
Gedichte von W. M. v. K. (aber anonym! Obertitel dazu:
"Bruderschaftslieder
eines rheinischen Poeten". S. 30 bis S. 32 im Heft) erscheinen
in einer
neuen
Publikation: Der Verleger Julius (Theodor) Bädeker/Baedeker
(1814–1860), hier in Elberfeld,
verkündet per
Anzeige im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel
(Ausgabe 27.5.1845) die ab 1. Mai erfolgte Auslieferung einer neuen
Heftserie:
"Gesellschaftsspiegel" |
"Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleuchtung
der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart". [X]
M. Heß
(also: Moses Heß) ist laut Titelblatt von Heft 1 der Redakteur.
[X] |||
Allerdings findet sich in den folgenden Heften 2 bis 12 (danach war
1846 Schluss mit der Reihe) kein weiterer
Teil mit der Überschrift "Bruderschaftslieder eines rheinischen
Poeten" mehr. [X] – W. M. v. M. wird aber dann 1846 ein ganzes Buch
unter
diesem Titel, allerdings: anonym!, publizieren, welches aber auch
umgehend von der
preußischen Zensur verboten wird. (Siehe weiter unten: 1846) |
Auch Friedrich Engels war in die
Heft-Gründung
involviert: "Das Neueste ist, daß Heß und ich vom 1. April
an bei Thieme & Butz in Hagen eine Monatsschrift:
"Gesellschaftsspiegel" herausgeben und darin die soziale Misere und das
Bourgeoisieregime schildern werden.." Engels in einem Brief an Marx
bereits am 20.1.1845 [X]
Und in einem Brief, begonnen am 22.2.1845,
Eintrag vom 7.3.1845: "Unser Gesellschaftsspiegel wird prächtig,
der erste Bogen ist schon zensiert und alles durch. Beiträge in
Masse. Heß wohnt in Barmen in der 'Stadt London'. Bergenroth wird
wahrscheinlich doch sobald nicht dorthin kommen, dagegen ein anderer,
den ich nicht nenne, weil dieser Brief doch wohl erbrochen wird." [X] |
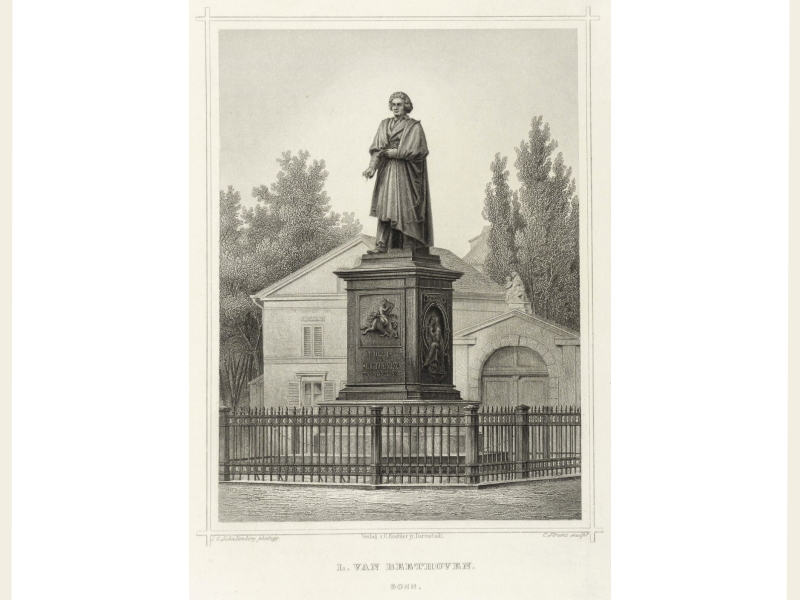
Hier
sehen wir das Beethovendenkmal in Bonn als bild-künstlerische
Version von C. Strunz, er ist der "sculp.", also der Künstler
für das Bild hier, vermutlich als Stahlstich (man findet jedoch
auch mal die Angabe Lithographie). Das Denkmal selbst entwarf Ernst
Julius Hähnel (1811–1891). Vorlage für den Stich hier aber
war eine Photographie von J. G. Schallenberg. Johann Georg Schallenberg
(1810–1863), gebürtiger Schweizer, war ab 1833 an der
Düsseldorfer Kunstakademie ein Schüler von Carl Ferdinand
Sohn. ||| Schallenberg ließ sich 1841 in Bonn nieder. [W] |||
Verlag für den Druck (in welcher Auflage fand der wohl statt?) war
der Verlag von C. (= Christian) Koehler jr. Darmstadt, alias Karl
Christian Koehler. Das Strunz-Bildnis wurde hier von K. J. verkleinert.
[X] Der Druck gilt als "Public Domain".  Vermutlich 1857 publiziert. Das Denkmal
wurde bereits am 12.8.1845 eingeweiht. Wolfgang Müller von
Königswinter publizierte dazu ein Beethoven-Gedicht, allerdings
zum 11.8., weil dann ursprünglich (nach den Planungen) der
Enthüllungsakt sein sollte. Siehe dazu auch direkt hier unten. [X]
Vermutlich 1857 publiziert. Das Denkmal
wurde bereits am 12.8.1845 eingeweiht. Wolfgang Müller von
Königswinter publizierte dazu ein Beethoven-Gedicht, allerdings
zum 11.8., weil dann ursprünglich (nach den Planungen) der
Enthüllungsakt sein sollte. Siehe dazu auch direkt hier unten. [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1845 |
Kölnische
Zeitung (5.8.1845): ANKÜNDIGUNG:
"Beethoven. Bei Henry u. Cohen in Bonn wird in den ersten Tagen
erscheinen: Beethoven, von Wolfgang
Müller, ein Gedicht, dargebracht bei der Inauguration
seines Monuments. Preis
7½
Sgr." (sgr. = Silbergroschen) [X] Oder man siehe Bonner
Wochenblatt
(8.10.1845) als anderes Anzeigen-Beispiel für das gedruckte W. M.
v. K.- Beethoven-Gedicht [X]
Aber wann wurde es wo vorgetragen? Laut
Titel
ja geplant am 11.8.1845 – Die
Einweihung/Enthüllung
des Denkmals in Bonn war dann aber (erst) (Feierlichkeiten dauerten
mehrere
Tage)
am 12.8.1845.
Siehe den vollständigen Gedichttext online auf einer Web-Page, DIREKT-LINK
zu Beethoven von Wolfgang Müller. Festgabe, dargebracht bei der Inauguration
seines Monuments am 11. August 1845.
|
Offenbar wurde im Programm der Queen
Victoria etwas
getauscht, sodass die Bonner
Enthüllung um einen Tag nach hinten
verschoben wurde: und zwar auf den 12.8.! [Quelle I] Unter den
Gästen
waren die
Königin Victoria von Großbritannien, der preußische
König Wilhelm IV. mit seiner Königin Elisabeth, der Musiker
(Hofkapellmeister) Dr. Franz Liszt und zudem Alexander von Humboldt.
Und
etliche weitere Persönlichkeiten: Erzherzog Österreich,
Prinzen, Herzöge etc.
|
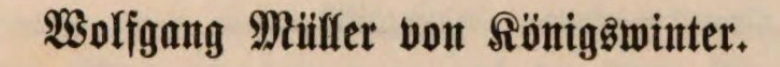
Wolfgang
Müller,
aber nun mit dem Zusatz "von Königswinter" .. war (nach bisherigem
Kenntnisstand) gedruckt als
feste Kombination erstmals im Jahr 1846 zu finden. [X] 1846 war jedoch
"von
Königswinter" noch kleiner und in einer extra Zeile gedruckt
... als der Künstlername "Wolfgang Müller". Siehe Bild
hier drunter. [X] Die Zeile als
Bild hier oben stammt von einem späteren Buch. ||| Auch der
abschließende Punkt war damals üblich, zusätzlich beim
Titel des Buches und bei Untertiteln et al., immer wieder taucht der
ordnende "Endpunkt" in den Zeilen auf.
Hier unten sieht man die Ur-Version der Kombination samt "von
Königswinter", bislang erstmals gedruckt vorgefunden für die
Publikation des Jahres 1846: "Rheinfahrt. Ein Gedicht von Wolfgang
Müller von Königswinter." Siehe auch in der Info-Tabelle hier
weiter unten bei 1846.

| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1845 ||| 4.10.1845 |
*
Geburt Emil Georg Brentano, der Ehemann
von der Tochter Tony/Antonia des W. M. v. K. ||| Dieser Emil
Georg
Brentano war am * 04.10.1845 in Frankfurt am Main geboren worden.
Er starb dann am + 27.10.1890 einige Jahre nach seiner Frau in
Winkel im Rheingau, liegt am Rhein, heute heißt es
Oestrich-Winkel.
|
Das Haus der Brentanos, "Brentanohaus",
dort in Oestrich-Winkel ist mit alten Möbeln und Tapeten etc. als
Museum
zu besichtigen.
www.brentano-haus.de
Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Wir erinnern uns an die Publikation des W. M. v. K. "Das Haus der
Brentano", erstmals publiziert 1874, und zwar als Serie in der
"Deutschen Romanbibliothek" (Zeitschrift als Beilage zu anderer
Zeitschrift). Siehe im Jahr 1874.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1846 |
W. M.
v. M. ist (vermutlich als "Wilhelm Müller") im Vorstand des Vereins der Ärzte des
Regierungsbezirkes Düsseldorf.
[X] Wann diese Tätigkeit begann, wann sie endete, muss noch
erschlossen werden.
Der bekannte Maler Caspar Scheuren hatte für
eben diesen Verein eine Urkunde (Diplom) entworfen, ein Diplom der
Mitgliedschaft, im Jahr 1846, und auf dieser Urkunde stehen sechs
Unterschriften, und eine
davon ist die (mir bekannte) von Dr. Müller. [X] |
Cöln
Levy-Elkan, 1846, das
verzeichnet die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zur
Druckerei der Ärzteverein-Urkunde.
HINWEIS K. J:: Wir kennen Levy Elkan oder D.
Levy Elkan
oder David Levy Elkan (1808–1865) a) als Lithographen, und wir kennen
ihn b) auch
als Verleger, der ab
1860 das Düsseldorfer Künstler-Album herstellte, ja,
Herausgeber
1860 war endlich mal wieder unser W. M. v. K., nachdem das
Künstler-Album
zuvor bis 1859 (offenbar bis zu einem Konkurs) bei Arnz & Comp.
erschienen war. Und Müller war die letzten Jahre bis 1859 nicht
aktiv dafür gewesen, obwohl er das allererste und einige folgende
redigierend verantwortete.
Nach dem
Konkurs von Arnz & Comp. geschah dann dieses: 1859 erwarben der
(bereits
genannte) Kölner Maler und Lithograf David Levy Elkan sowie der
Buchhändler Heinrich Bäumer den Betrieb.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1846 |
Das
Buch "Rheinfahrt" von
1846 hat
endlich auch "von Königswinter" als Bestandteil des
Müller-Namens. (Siehe hier oben ein Beispiel in
Frakturschrift. Hier allerdings aus einem späteren Buch von
1861.)
In dem Buch "Rheinfahrt" stand "von Königswinter"
allerdings noch etwas kleiner – und zudem in der zweiten Zeile.
Später wurde dann alles in anderen Büchern in einer Zeile gedruckt, damals
auch typisch: der Punkt am Ende. In Büchern verschiedenster
Autoren und Autorinnen findet man diesen Punkt. Auch am Ende des
Buchtitels oder am Ende des Verlagsnamens findet man solch einen Punkt.
(Siehe weitere Details in: Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen
|
1846: Gründung der
städtischen
Gemäldegalerie in Düsseldorf.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1846 |
ANONYM (!!!) von W. M. v.
K. publiziert, "Bruderschaftslieder
eines
rheinischen Poeten", diese erscheinen beim Verlag Leske,
Darmstadt, ca.
336 Seiten ||| Das Buch wird von der preußischen Zensur zum
8.2.1846 verboten. [Quelle B, Seite 214 und dazu dann weiter Seite 407,
Anmerkung 19. – In Anmerkung 19 auf Seite 407 steht dann Luchtenbergs
Ur-Quelle: F. Herm. Meyer, Bücherverbote im Königreich
Preußen 1834 bis 1882, im Archiv für die Geschichte des
deutschen Buchhandels, Band 16, Leipzig 1891. Seite 333.] – Und: [X]
findet
noch diese Ur-Ur-Quelle zum Müller-Buch-Verbot: Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz, I. HA Rep. 101, H
Nr. 09 Bd. 4
Kontext:: Oberzensurkollegium und
Oberzensurgericht >> 02. Oberzensurgericht (1838 - 1848) >>
02.02. Staatsanwaltschaft beim Oberzensurgericht (1843 - 1848) |||
Laufzeit: 1846 |
Darin (siehe links die Infos GEHEIMES
STAATSARCHIV) Vermerke auch zu "Bruderschaftslieder
eines rheinischen Poeten" (Verleger, Buchhändler C.W. Leske,
Darmstadt), das wäre also das anonym publizierte Buch von W. M. v.
K.
[C = Historisches Archiv der Stadt Köln, Eifelwall 5, 50674
Köln. Der Müller-Bestand hat die Verzeichnis-Nummer 1141.] [B
=
Luchtenberg, Paul (1959): Wolfgang Müller von
Königswinter. 2 Bände. Köln: Verlag Der Löwe, Dr.
Hans Reykers (Veröffentlichungen des Kölnischen
Geschichtsvereins e. V., 21).
[[ -- HINWEIS: W.
M. v. K. taucht hier
als "rheinischer Poet" im Buchtitel auf, wenngleich anonym. Seine
6-Band-Ausgabe 1871
ff., teils posthum erschienen, wird "Bekenntnisse eines rheinischen
Poeten" heißen. Als "rheinischen Chronisten", Betonung auf
Chronisten, hatte er sich zudem in einer Publikation 1861 bezeichnet.
-- ]]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1847 ||| 22.3.1847 |
Die "Düsseldorfer Zeitung" bringt am 22.3.1847 auf ihrer
Titelseite ein Pro-Müller-Gedicht, geschrieben hat es
Richard von Lumm. Es beginnt so:
An
Wolfgang
Müller (= TITEL)
„Nur
Lieder! — And'res hab' ich
nicht!" (= UNTERTITEL, plus "Wolfgang Müller.", weil's
Zitat ist)
:::
Wolfgang Müller.
(IST SCHON ERSTE ZEILE TEXT)
Dir dieses Lied, so frisch und
frank.
Dir Gruß und Handschlag.
Rheinlandsänger,
Drr meines Herzens
wärmster Dank —
Ich halte ihn zurück nicht
länger;
Mein Lied, es kling' hinaus zu
Dir.
Hinaus ins Land, stromauf und
nieder.
Durch's weite stolze
Rheinrevier.
SPÄTER IM GEDICHT (8 Strophen) FINDET MAN AUCH DIESE
ZEILEN: Du sangst des einst'gen
Friedens Reich, Wo alle Menschen frei und gleich. [X]
Richard von Lumm war
möglicherweise einer der Inhaber der (später dann so
heißenden) Seidenwa(a)renfabrik
"Schramm & von Lumm". [X] Zudem: Das "Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel ..." meldet am 2.12.1880, also Jahrzehnte nach
1847, wir wissen nicht, wann die Texte entstanden: Vom Schwarzwald zum
Rhein,
Ein Liedercyklus von Rich. von Lumm.
(Lumm als Textdichter.) Solostimmen und Chor mit Begleitung des
Pianoforte. Ernst Hermann Seyffardt (1859-1942) ist der
Komponist. [X] Richard von Lumm wird genannt in der
"Festschrift zur Enthüllung des Krieger-Denkmals zu Crefeld
(1875)", er war in dem Comitee zur Errichtung eben dieses Denkmals mit
dabei. [X] Ein Richard von Lumm, geb. 5. Oktober 1872 zu Crefeld,
evangel., als Sohn des verstorbenen
Kaufmanns Richard von Lumm (!), taucht 1890–91 am Realgymnasium
zu Crefeld (heute: Moltke-G.!) als Abiturient auf. [X] 4 x von Lumm
finden sich bereits 1834 im Adressbuch für Rheinland-Westphalen in
Crefeld bzw. Krefeld, S. 361. [X] Im Adreß-Buch vom
Regierungs-Bezirk Düsseldorf 1861 (gedr. bei Lucas in Elberfeld)
findet sich "Schramm & von Lumm", Sammetbandfabrik Ostwall 164 a,
zugleich auch noch Schramm, Seidenwaarenfabrik mit 2 a, Friedrichsplatz
12, Seite 159. [X] Die Samtband-Firma "Schramm & von Lumm" ist auch
im "Katalog der Allgemeinen deutschen Industrie-Ausstellung zu
München im Jahre 1854" vertreten, auf Seite 181. Mit einem
"Sortiment von ganzseidenen Sammtbändern". [X]
|
Eine weitere Ehre für Müller ist einige Tage später zu
lesen: "In dem Feuilleton der Düsseldorfer Zeitung, Nr. 78, ist
bereits angekündigt worden, daß über
die, nach der Dichtung des
Wolfgang Müller: 'Die Rheinfahrt,' auf dem Masken-Balle von
hiesigen Künstlern dargestellten Figuren, von Herrn Maler
Camphausen eine lithographirte Komposition aus 2 Blättern
von je zwei Abtheilungen vorliege. [Düsseldorfer Zeitung 9.4.1874]
[X]
Auf der Düsseldorfer Kunstausstellung von 1847, zu der es eine
sehr lange Besprechung gab,"von einem Laien", über etliche
Ausgaben der "Düsseldorfer Zeitung" hinweg, Beginn in Nr. 226 am
Montag, 16.8.1847, von einem "...x....." (sollte das eventuell
Müller gewesen sein?), auf dieser Ausstellung muss es auch ein
Bildnis erschaffen von dem Maler Leutze (Emanuel
Gottlieb Leutze, 1816–1868) von/zu Dichter Dr. Wolfgang
Müller gegeben haben, laut Artikelschreiber "etwas über's
Knie gebrochen und befriedigte nicht". [DüZei, 2.9.1847. "Urtheile
eines Laien über die diesjährige Düsseldorfer
Kunstausstellung."] [X]
|
1847 ||| 12. September 1847 Im badischen Offenburg gibt es eine
Versammlung "entschiedener Freunde der Verfassung", einberufen von den
beiden Demokraten Friedrich Hecker und Gustav Struve, "Forderungen des
Volkes" beschlossen. Diese "Offenburger Erklärung" wird
überaus bekannt und so letztlich bedeutsam in ganz Deutschland.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1847 ||| 8.11. oder 9.11.1847 |
8.11.1847,
Donnerstag, oder 9.11.1847,
Freitag, Hochzeit ⚭ W. M. v.
K.
(als Wilhelm
Müller natürlich, sein amtlicher Name!) und Emilie Schnitzler.
Für den 8.11.1847 als amtlichen Hochzeitstag spricht: "Heirathen. Peter
Wilh. Karl
Müller, med. Dr., v. Königswinter, und Emilie Schnitzler, v.
Solingen." Abgedruckt in Kölnische Zeitung (12.11.1847). Es
sind
allerdings am 12.11. gedruckt de facto die AMTLICHEN
NACHRICHTEN = "Civilstand der STADT KÖLN" vom 8.11.1847. In der
Rubrik "Heirathen" waren Müller/Schnitzler die einzigen. [X]
Eine Hochzeits-Feier am 9.11.1847 erschließt sich
offenbar
aus Quelle E, S. 164. Außerdem wissen wir aus Quelle B, Bd. 2, S.
383, dass Müller und Ehefrau am 9.11.1872 die "Silberne Hochzeit"
feierten. Das spräche für 9.11. [X]
Müllers Bruder August
schreibt allerdings einen Gedicht-Text für einen Tag
danach, für den 10.11.1847: "An Wilhelm Müller
und Emilie Schnitzler zum Tage ihrer
Vermählung zum 10. November 1847", offenbar gedruckt bei
Voss (bzw. geschrieben: Voß),
Düsseldorf. [Quelle: ULB Heinrich-Heine-Universität] [X] –
Vielleicht war donnerstags 8.11. oder freitags 9.11.1847
Standesamt, aber am Samstags am
10.11.1847 dann kirchlich und die eigentliche Feier?, fragt (sich) K.
J. – Oder, sehr eventuell nur, beim Druck
des Festgedichtes ging der Bruder noch vom 10.11. als standesamtlichem
Hochzeitstag aus?
|
VERTRAG: Am 6.11.1847 hatten beide
einen Ehevertrag unterschrieben. "Heiratsvertrag
zwischen Dr. Wilhelm
Müller, Düsseldorf, und Fräulein Emilie Sch(n)itzler,
Köln, vom 6. November 1847, Köln" [Quelle C]
[Heiratsvertrag
in Druckschrift abgedruckt in Quelle B, Bd 1, S. 410/411 (= Anmerkung
37)], Vermutung K. J.: Federführend beim Vertrag waren die
Bankiers-Eltern Schnitzler. HINWEIS: Das Eltern-Ehepaar Schnitzler
verpflichtet sich in diesem Vertrag, eine regelmäßige
Jahresrente von "ein tausend berliner Thaler" zu zahlen, an das
Brautpaar
Wilhelm/Emilie! Ehepaar Schnitzler unterzeichnet auch, Müllers
Mutter unterzeichnet nicht.
W. M. v. K. (also bürgerlich immer Wilhelm Müller) hatte
mit Emilie Schnitzler später diese 5 Kinder (3 Söhne, 2
Töchter):
1) Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4)
Else 1856–1933 5) Tony 1857–1883
[Siehe
Quelle B, Bd. 2, Anmerkungen auf S. 394, Daten darin offenbar entnommen
aus Quelle E, Seite 170.] [X]
|

Emilie
Schnitzler, seit November 1847 verheiratet zu Emilie Müller
(1822–1877), Emilie, die Ehefrau von Wolfgang Müller von
Königswinter. Dieses Foto ist ein Bildausschnitt, den K. J.
vornahm. Das Gesamtfoto stammt vermutlich aus dem Jahr 1863. (Siehe
dazu weiter unten, bei 1863). ||| Wikimedia Commons als hier
gewählte Bildquelle
kennt hingegen keine Jahreszahl. Bild-Quelle: Wikimedia Commons, dort
das (allerdings undatierte) Foto der Familie
Müller: Wolfgang und Emilie plus ihre fünf Kinder. [X]
1848 ||| 27.2.1848 Baden. Es formulierte die Mannheimer
Volksversammlung am 27. Februar 1848 die “Märzforderungen”.
1848 ||| 3.3.1848 In
Düsseldorf, wo W. M. v. K. wohnte, fand am Abend des 3. März
1848 eine öffentliche Bürgerversammlung statt. Die rund 500
Teilnehmer der Düsseldorfer Versammlung diskutierten über
eine liberale Petition, die von Hugo Wesendonck mitausgearbeitet worden
war. (jener Wesendonck, zu dem es heißt, der Arzt Wilhelm
Müller (alias "Wolfgang Müller von Königswinter") sei
später im Jahr 1848 sein Stellvertreter für das Mandat in der
Frankfurter Nationalversammlung gewesen. Wäre noch zu
überprüfen.
1848 ||| 18.3.1848 Berlin, revolutionärer Aufstand,
Stichwort:
Märzrevolution. Barrikadenkämpfe. Circa 270 Tote bei den
Aufständischen.
1848 ||| 19.3.1848
Preußisches Kabinett unter Adolf Heinrich Graf von
Arnim-Boitzenburg 19. März 1848 bis 29. März 1848. Kabinett
Arnim-Boitzenburg.
1848 ||| 29.3.1848
Preußisches Kabinett unter Ludolf Camphausen. 29. März 1848
bis 20. Juni 1848. Kabinett Camphausen-Hansemann.

Solch
eine Eintrittskarte für den 31.3.1848, wohlgemerkt: zum Vorparlament in Frankfurt,
müsste auch Wolfgang Müller
(W. M. v. K.) erhalten haben. Hier ist es die von Friedrich Siegfried
Jucho. Quelle. Wikimedia Commons, Direkt-Link.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
1848 ||| 31.3.1848 und
18.4.1848 |
In Düsseldorf (Parlamentssitz der
preußischen Rheinprovinz) wurde der "Verein
für
demokratische Monarchie" gegründet. Am 18. April 1848.
Vereinszweck war: „über den Grundsatz der Volksherrschaft, mit
einem Fürsten an der Spitze, nach Innen und Außen zu
belehren“. Kern-Idee: Konstitutionelle Monarchie in Form von
Demokratie. Vorsitzender Hugo Wesendonck. Müller (W. M. V. K.) ist
offenbar Mitglied dieses Vereins und wird später im
Franfurter Vorparlament
(tagt nur wenige Tage: 31.3. bis 4.4.1848) sitzen, danach aber
zumindest/immerhin formeller Stellvertreter
für
den Paulskirchen-Delegierten in der Frankfurter
Nationalversammlung für Wahlkreis 25, Rheinland, Düsseldorf,
Hugo Wesendonck, sein. (Siehe dazu auch bei 11.5.1848.)
Wesendonck seinerseits war vom 18. Mai 1848 bis 18. Juni 1849
Abgeordneter. Und zwar (in jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten)
für diese
Fraktionen: Deutscher Hof / Donnersberg / Märzverein.
In „Deutsche Parlaments-Chronik. Ein
politisches Schulbuch für's Deutsche Volk. Herausgegeben von J.
Meyer. Illustrirt mit Porträts, Lokalansichten,
Situationsplänen und Karten. Erster Band", "Druck und
Verlag des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen, 1848." XVI,
768 Seiten, [17] Bl.“, wird W.
M. v. K. in der Liste "Die Frankfurter Versammlung zum Vorparlament"
geführt, siehe S. 6, aber kurz: „Müller, Dr. med., von
Düsseldorf.“ [X] Vor ihm steht qua Alphabet "Mülhens
von
Köln.", einer von der 4711-Dynastie: Es war Peter Joseph/Josef
Mülhens. [X]
Kurioserweise siedelten sich eben diese Mülhens selber in
Königswinter an. 1843 hatte die Familie Mühlens den
Wintermühlenhof erworben. Ob "Wolfgang Müller von
Königswinter" (alias Dr. Wilhelm Müller) das 1848 wusste?,
fragt sich K. J. ||| Peter Joseph/Josef Mülhens, Kölner,
Unternehmer (Sohn des Begründers des Hauses 4711, Wilhelm
Mülhens) war Erbpächter des Gutes. Bekannt wurde in und mit
Königswinter später
vor allem Ferdinand Mühlens (1844–1928),
|
Man liest: Die
Düsseldorfer Bürgerwehr wurde
bereits am 18.3.1848 ins Leben gerufen, einen
Tag bevor König Friedrich Wilhelm IV.
(Regentschaft 1840-1858) in Berlin die
Aufstellung von Bürgergarden
genehmigte. [Quelle: www.rheinische-geschichte.lvr.de ]
||| Und in einem anderen Text [Quelle: ABER DIESE HOMEPAGE IST NICHT
MEHR
IM NETZ:
historisches-zentrum-wuppertal.de] lesen wir:
"Ende März 1848
waren
der
achtunddreißigjährige Kaufmann und Oberst der Schützen
Lorenz Cantador zum Chef der Bürgerwehr und der zwei Jahre
jüngere Maler Lorenz Clasen zu seinem Stellvertreter gewählt
worden. Mit Cantador war ein entschiedener Demokrat an die Spitze der
Bürgerwehr getreten. Dieselbe politische Einstellung hatten die
Bürgerwehroffiziere Hugo Wesendonk, Wolfgang Müller
und
Stephan Kuhl." |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1848 ||| 10.5.1848 |
Bei den Wahlen zur deutschen
Nationalversammlung in Frankfurt, dem berühmten
Paulskirchenparlament, wurden am 10.
Mai 1848 Herr Rechtsanwalt Hugo Wesendonck aus Düsseldorf zum
Abgeordneten und Herr Dr. med. Wolfgang Müller aus Düsseldorf
zum Stellvertreter gewählt. [Das steht offenbar in dieser
Quelle: Konrad Repgen, Märzbewegung und Maiwahlen des
Revolutionsjahres 1848 im Rheinland (Bonner historische Forschungen,
Bd. 4), Bonn 1955, S. 311 ff.] [X]
|
Wesendonck wird anderthalb Jahre
später im Dezember 1849 wegen eines Hochverratsprozess in die USA
fliehen. Er wurde dann in Abwesenheit 1850 zum Tode verurteilt. Huge
Wesendonck blieb bis zu seinem Tod 1900 in den USA. (Die ebenfalls
bekannte Wagner-Freundin Mathilde Wesendonck war seine Schwägerin.)
|
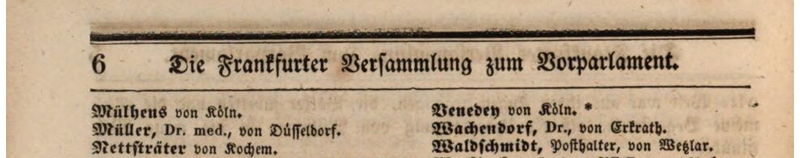
Dr. Wilhelm Müller alias "Wolfgang Müller von
Königswinter" war Mitglied im Vorparlament in Frankfurt, Betonung
liegt auf "Vor..." ||| Auszug
aus dem Buch "Deutsche Parlaments-Chronik" von 1848, Seite 6, siehe
Quellenangabe beim Eintrag zum 31.3.1848 und 18.4.1848 hier oben in
dieser Zeitleiste.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1848, frühestens Juni |
1848 – W. M. v. K.s Buch "Oden der
Gegenwart" erscheint. |
1848 ||| W. M. v. K.s Buch "Oden der
Gegenwart" erscheint, 144
Seiten, bei der "Verlagshandlung Julius Buddeus" in Düsseldorf, im
Buch-Haupt-Titel steht "Wolfgang Müller", allerdings ohne den
Zusatz "von Königswinter". Ein letztes Gedicht darin ("An
das
Deutsche Volk") ist mit dem Datum 19. Juni versehen. Das Buch muss also
nach dem 19.6.1848 erschienen sein. [X] – Darin u. a. fünf
Gedichte/Oden als
thematische Gruppe wie "Die Berliner Märztage: Die Stimme des
Volkes (17 März), Der erste Schuß (18 März), Rath
und Verrath (24 März), Der Sieg des Volkes (25 März), Die
Sühne (27 Mai)". [X]
|
1848 ||| 25.6.1848
Preußisches Kabinett unter Rudolf von Auerswald. 25. Juni 1848
bis 21. September 1848. Kabinett Auerswald-Hansemann.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1848 ||| Juli 1848 |
Beim Düsseldorfer
Schützenfest, und das passiert in einer hochrevolutionären
Zeit, man darf es nicht mit den "Schützenfesten" von heute
verleichen, wird auch ein Text von W.
M. v. K. gesungen. [Quelle:
Düsseldorfer Journal und Kreisblatt vom 19.7.1848] |
Wir erinnern uns an die
revolutionäre Bürgerwehr des Lorenz Cantador, gegründet
März 1848, in Düsseldorf.
Außerdem gilt: Das Düsseldorfer Jäger-Corps wurde
bereits 1844 durch Lorenz Cantador gegründet und die Gesellschaft
Jäger-Corps 1844 stellt auch
heute noch die älteste Kompanie im I. uniformierten
Bataillon des St. Sebastianus Schützenverein 1316 e.V.
Düsseldorf.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
6.8.1848
und 11.8.1848 |
Müller
und die Künstlervereinigung "Malkasten"
in Düsseldorf. Hier: 6.8.1848, Fest der deutschen Einheit.
Offenbar (noch provisorischer) Beginn der Künstlervereinigung. |||
Seine
(Müllers) offizielle
Mitgliedschaft (als Nicht-Maler!)
beginnt aber erst später. (Siehe November 1850.) – Ja, W. M. v. K.
wird als Nicht-Maler auch Mitglied sein. [Quelle H, S. 14]
Am 6.8.1848 wurde in Düsseldorf das hochpolitische
Einheitsfest aller Deutschen gefeiert.
Veranstalter: "Verein für demokratische Monarchie".
Düsseldorfer Künstler hatten
eine große Germaniastatue
errichtet, vor der Cantador eine
Parade der Bürgerwehren aus
Düsseldorf und Umgebung abnahm.
[Quelle: www.rheinische-geschichte.lvr.de, z. B. Artikel zu Laurenz
Cantador]
11.8.1848: Erste offizielle Versammlung "Malkasten". Später kann
der "Malkasten" mit seinem eigenen Vereinsgebäude, dem ehemaligen
Jacobi-Gut in Pempelfort, ein bedeutsamer Ort in Düsseldorf
werden, heute würde man sagen: Location. (Müller wird
später z. B. dazu den Text "Aus Jacobi's Garten" schreiben.)
|
Man gründete
im Rahmen der Feierlichkeiten eine Künstlervereinigung, der man
wenige Tage später den Namen "Malkasten" gab. Den Namen
"Malkasten" gaben sie der
Künstlergesellschaft bei ihrer ersten Versammlung am 11. August,
an der 112
Personen als Gründungsmitglieder teilnahmen. Der
"Düsseldorfer
Malkasten" besteht bis heute. Wolfgang
Müller von
Königswinter
wird dazu den Artikel publizieren: "Aus dem Malkasten zu
Düsseldorf", es ist
eine Art von Stadterwanderung zu diesem Themenkreis "Malkasten".
Publiziert in: "Die Gartenlaube". Heft 37, 1863, S. 585–588. – EIN
ZITAT: "Wir stehen mitten im 'Malkasten', der hier sein Sommerlocal
aufgeschlagen hat. Mit Beginn der schönen Jahreszeit verlassen
nämlich die Düsseldorfer Künstler ihre
gemüthlichen, aber an hellen Tagen etwas düstern Räume
in der Ratingerstraße, um sich in der frischen fröhlichen
Frühlingswelt an Licht, Luft, Grün, Blüthe und
Vogelliedern zu erquicken." [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1849 ||| 7.4.1849 |
Ein Müllertext, Santa
Cäcilia, dramatische Legende, vertont von Ferdinand Hiller, wird
am 7.4.1849 als einer von vier bedeutsamen Programmpunkten beim
"großen Musikfest" Düsseldorf aufgeführt. [X]
|
Siehe auch Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen zu Wolfgang
Müller von Königswinter. |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1848 ||| 14.8.1848 |
Besuch von König
Friedrich Wilhelm IV. in Düsseldorf am
14.8.1848. Friedrich Wilhelm war mit einem
Pfeifkonzert empfangen und bei seiner
Kutschfahrt über die Kastanienallee
(heute Königsallee) mit
Pferdeäpfeln beworfen worden. (Ein
historisch berühmter Vorfall:
In der Folge kam es zu Auseinandersetzungen zwischen einer bewaffneten
Düsseldorfer Bürgerwehr und preußischen Soldaten.
|
_ |
1848 ||| 3.10.1848 "Process" gegen den Dichter
Ferdinand Freiligrath, ein enger Freund des W. M. v. K., angeklagt
der Aufreizung zu hochverrätherischen Unternehmungen
durch das Gedicht: Die Todten an die Lebenden, verhandelt vor dem
Assisenhofe zu Düsseldorf
am 3. Oktober 1848. ||| Freiligrath wurde von allen Anklagepunkten
freigesprochen, direkt nach Verkündigung des Urteils und in einem
triumphalen Fackelzug unter begeisterter Anteilnahme der
Bevölkerung nach Hause geleitet.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1849 |||
[26.] - 28.8.1849 |
Goethe-Feier
= "Feier des hundertjährigen
Geburtstags Göthe's" ["im
Geisler'schen Lokale", veranstaltet vom Allgemeinen Musik-Verein und
den
"Künstlern Düsseldorfs"]:
TAG 1, 26.8.1849, ist rein musikalisch. "Großes Vocal- und
Instrumental-Concert". [X]
TAG 2, 27.8.1849, abends ab 19:00 Uhr: 1) "Lebende Bilder nach
Göthe'schen Dichtungen" sowie 2) "Dramatischer Festzug". Weiter heißt es zu diesem folgenden
TAG 2: "Die
zu diesem
Festabende gehörige Dichtung von Wolfgang Müller, die
begleitende Instrumental-Musik von Ferdinand Hiller." [X]
TAG 3, 28.8.1849, ist dann ein Festmahl.
Für das "Fest-Comité"
haben die Anzeige gezeichnet: A. Achenbach. Becker. Bloem. I.
Camphausen. Ernsts. Euler. Hausmann. F. v. Heister. Hertz. Hildebrand.
Hiller. Jordan. Köhler. Leutze. v. Leezack. Michelis. Mücke.
Müller. Nielo. v. Norman. Schleger. Sohn. Wintergerst." [X] W. M.
v. K. war also in diesem Festkomitee, und das offenbar auch sehr aktiv.
[X]
[Quelle. Siehe die
Anzeige in der "Kölnischen Zeitung" vom 12.8.1849 und ebenfalls im
"Düsseldorfer Journal und Kreisblatt" vom 12.8.1849] [X]
|
Es gibt zum dem "Festumzug" vom TAG 2
auch 33
Seiten gedruckte Erläuterungen, offenbar von Müller selbst,
erschienen bei der Buddeus'schen
Buch- und Kunsthandlung (Ed. Schulte). Siehe dazu auch bei Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen zu Wolfgang
Müller von Königswinter.
1880, also rund 30 Jahre nach dieser
Goethe-Feier, übernahm die Stadt
Düsseldorf den Geisler'schen Saal und errichtete hier in
zweijähriger Bauzeit die (erste) "Tonhalle". |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1850 ||| 20.3.1850
|
* Max,
Geburt des ersten Kindes (und
ersten Sohnes) von W. M. v. K. und seiner Ehefrau Emilie am *
20.3.1850
in Düsseldorf, Max
Müller wird am + 7.2.1908 mit 57 Jahren versterben. Er war
türkischer
Konsul in Antwerpen.
[Quelle E, S. 170, und zwar ist das so laut Quelle B, Bd. 2, S. 394]
W. M. v. K. (also bürgerlich immer Wilhelm Müller) hatte
mit Emilie Schnitzler später diese 5 Kinder (3 Söhne, 2
Töchter):
1) Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4)
Else 1856–1933 5) Tony 1857–1883
[Siehe
Quelle B, Bd. 2, Anmerkungen auf S. 394, Daten darin offenbar entnommen
aus Quelle E, Seite 170.]
Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich der * 27.3.1856
als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort.
|
Hinweis K. J. Es gibt eine Akte zu
einem Max Müller als Konsul in Antwerpen für das Osmanische
Kaiserreich 1882. In "het archief van de provincie Antwerpen,
Consuls, 1861-1937" / Und zwar: in "het Rijksarchief in België".
[X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
1850 ||| 2.9.
und 3.9.1850 |
Robert
Schumann, Clara Schumann und Kinder treffen am 2.9.1850 in
Düsseldorf ein, man übernachtet im Breidenbacher Hof, und die
Schumanns besuchen bereits am 3.9.1850 u. a. auch die Familie
Müller. ||| Und am 7.9.1850 (Sonntag)
sind die Schumanns bei einem Konzert, nachher findet ein Souper mit
Hasenclevers, Dr. Müllers,
Schadows, Hillers statt. ||| Oder: 18.9.1850. Freitag.
Schuhmanns sind bei Eulers (NOTAR) in Flingern (Düsseldorf)
mit den Müllers und Prof.
Stilke samt Frau. ||| 21.9.1850. Montag.
Schuhmanns bei Müllers,
beide
(Müller) mag sie gern. Sie, also Clara Schumann, mag Frau
Müller ganz besonders, als Art Vertraute, der man sich näher
anschließen kann. [Quelle für alle vier Tages-Ereignisse: G]
[X]
Am 2. September 1850,
abends 7 Uhr, kam Robert Schumann mit seiner Familie in Düsseldorf
auf dem Köln-Mindener Bahnhof an. Er war der neue Städtischer
Musikdirektor von Düsseldorf. Er leitete in dieser Funktion auch
die Kirchenmusik in der Maxkirche, ja, der Kirche der katholischen
Familie Müller. Robert Schumann mit Clara Schumann und Kindern,
sie wohnten später u. a. (letzte Düsseldorfer
Wohn-Adresse von insgesamt vier Adressen in Düsseldorf) im Haus
des Weinhändlers
Aschenberg in der Bilker Straße Nummer 1032 (heute Bilker
Straße 15). Dort entsteht gerade durch Umbau (2023 Eröffnung
geplant) ein
Schumann-Museum.
W. M.
v. K. wird bis 1853 (Müller-Umzug nach Köln) der Arzt der
Familie Schumann in Düsseldorf sein.
|
Zitat aus dem Tagebuch der Clara
Schumann:
"Dienstag, den 3., machten wir mit
Hiller Besuche bei Professor
Sohn, Professor Wichmann, Direktor Schadow, Dr. Hasenclever und
Dr. Müller (von Königswinter). Nachmittags begannen wir,
Logis zu
suchen, fanden aber die Häuser alle unkomfortabel,
ungemütlich große
Fenster, ganz flache Mauern, die Höhe durch garstige große
Wände
(Waschküchen hier genannt) verbaut, für die Hausfrau auch gar
keine
Bequemlichkeiten, kurz wir waren sehr enttäuscht, denn da
Düsseldorf
so im Grünen liegt, konnten wir nicht denken, daß es schwer
halten
würde, ein Logis im Grünen und mit Garten zu bekommen. Die
meisten Leute haben hier ganze Häuschen und immer in jeder Etage
nur 3 – 4 Fenster Front. Die Häuser sind teuer und uns der
Gedanke,
oben Eins, unten Eins, Eins in der Mitte zu wohnen, schrecklich."
[Quelle G, S. 223/S. 224.] |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1850, circa
November |
Circa November 1850 oder etwas
später ||| W.
M. v. K. wird als
Nicht-Maler in der Künstlervereinigung "Malkasten" in
Düsseldorf auch Mitglied sein. Wahrscheinlich ab November
1850
etwa. Es gab in 1850 eine entsprechende Satzungsänderung.
[Quelle F, S. 14]
|
_ |
1850 ||| 4.12.1850 Das
sogenannte Kabinett "Manteuffel" war vom 4. Dezember 1850 bis 6.
November 1858 aktiv. Er als Ministerpräsident für
Preußen. Es folgte das
Kabinett Hohenzollern-Sigmaringen ab 6. November 1858 bis 11. März
1862. Danach das Kabinett Hohenlohe-Ingelfingen vom 11. März bis
23.
September 1862. Bezogen auf die Lebenszeit von W. M. v. K., Tod
1873, ist auch noch höchst wichtig: Das Kabinett Bismarck/Roon vom
23.
September 1862 bis 30. März 1890, Bismarck (vorher auch Bundeskanzler) war dann ja
in der neuen/neugeschaffenen Position Reichskanzler
ab 4.5.1871 des Deutschen Reiches, Reichsgründung war bekanntlich
im Jahr 1871. [[ 17. Januar 1871, Spiegelsaal von Versailles, es
versammeln sich etwa 1400 Personen, die deutschen Fürsten, hohe
Militärs sowie die Spitzen der Hof- und Staatsbehörden . Es
soll mit einer Zeremonie der Kaisertitel irgendwie offiziell und
zugleich als Demütigung für Frankreich bestätigt werden.
]]
Albrecht von Roon spielte vom 1.1.1873 bis 9.11.1873 den
Ministerpräsidenten, jetzt Kaiserreich. Preußen und das
(neue) Reich 1871 und seine
Kabinette um 1871 ff. gingen irgendwie ineinander über. [W]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1851 |
Das
erste (!) "Düsseldorfer Künstleralbum"
erscheint, "redigirt" von "Dr.
Wolfgang Müller", ja, so steht es dort. Einerseits der
reale
Arzt-Doktor-Titel, andererseits sein Künstlervorname "Wolfgang".
[X]
Müller wird das
Album/Jahrbuch einige Male redigieren, aber nicht
immer !!! ACHTUNG !!! Da finden sich oft falsche Informationen! Er wird
auch nicht in jedem Künstler-Album
mit eigenen
Beiträgen vertreten sein.
Das "Düsseldorfer Künstler-Album" erscheint von 1851 bis
1866. (MÜLLER ist verantwortlich 1851 und 1852, evtl. 1853
((derzeit ungewiss)), sicherlich jedoch nicht 1854 bis 1859, aber
dann endlich wieder 1860–1866, bis zum letzten Album der
"Düsseldorfer"-Reihe). Siehe auch: Liste
Publikationen W. M. v. K..
|
Im ersten Buch/Album 1851 ist W. M. v.
K.
zusätzlich zum
Redigieren mit dem eigenen Langgedicht
"Teodoro Calegero" vertreten
(Illustration: J. Sonderhausen)
:::
mit dem eigenen Gedicht
"Herbstfeier"
(Illustration: Th. Mintrop)
:::
mit dem eigenen Gedicht
"Hermann Grin"
(Illustration: W. Camphausen)
:::
mit dem eigenen Gedicht
"Jung Florian"
(Illustration: E. Leutze)
:::
mit dem eigenen Gedicht
"Die Zwergenamme"
(Illustration: W. Camphausen)
:::
mit dem eigenen Gedicht
"Wolf Eberstein"
(Illustration: E. F. Lessing)
:::
und noch mit dem eigenen Gedicht
"Der Junker von Vollmarstein"
(Illustration: W. Camphausen) [X] ||| "Düsseldorfer
Künstler-Album
mit artitstischen Beiträgen von [ES FOLGEN NAMEN] unter
literarischer Mitwirkung von [ES
FOLGEN NAMEN] redigirt von Dr.
Wolfgang Müller. 1. Jahrgang. 1851. Düsseldorf. Druck und
Verlag des lithographischen Instituts von Arnz & Comp." So
lautet der Haupt-Titel. [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1851 ||| 31.1.1852 |
Bei der Taufe von Clara
und Robert Schumanns vierter Tochter Eugenie Schumann am
31.1.1852 war W. M. v. K.
Taufpate.
[Quelle: R]
|
Eugenie Schumann. * 1. Dezember 1851 in
Düsseldorf | + 25. September 1938 in Bern. [W]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1851 |
3.2.1851 Datum der Urkunde über die
Beförderung des Unterarztes der
Landwehr Dr. Karl Wilhelm Müller zum Assistenzarzt
der Landwehr.
[Quelle C] Es ist de facto unser W. M. v. K., hier aber mit seinem
bürgerlichen Namen.
|
"Lorelei. Rheinische Sagen" des W. M.
v. K. erscheint 1851 (frühestens im Mai) bei "Verlag der M.
DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung". Das Buch hat insgesamt rund 334
Blattseiten. (Das Widmungsgedicht an Uhland stammt vom Mai 1851.)
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 12.8.1852 |
BEISPIEL: Müller als Arzt. Hier
bei
den heute so prominenten Schumann(s).
|
12.8.1852: Familie
Schumann, Düsseldorf, Clara
und Robert: Man fasst auf Anraten des Arztes der Familie (und das ist
W. M.
v. K., jener "Dr. Müller" bei Clara in den Aufzeichnungen) den
Entschluss, auf eine Kur
nach
Scheveningen (Holland) zu gehen. [Quelle G, S. 270/271.] [X] [Siehe
etwas weiter unten den kompletten Text der zwei Seiten aus der
Litzmann-Schumann-Quelle G, in heutiger Schrift, mit Hilfe von OCR
erfasst von K. J.]
Laut Tagebuch
von Robert Schumann selbst ist diese Scheveningen-Reise am 12.8.1852
nachts in
Düsseldorf begonnen worden. [Quelle: S = Schumann-Tagebücher,
Bd.
2, Seite 434.]
Schumann war bereits 1851, und zwar im
Juli/August 1851, in der Schweiz und in Antwerpen. [Quelle: S =
Schumann-Tagebücher, Tagebuch 21, S. 422 ff.] [X] Robert Schumann
traf dabei am 16.8.1851 in Antwerpen u. a. auf
den Bruder
von W. M. v. K. [Quelle: S = Schumann-Tagebücher, Bd. 2 für
1836–1854, hrsg. von Gerd Nauhaus, 756 S., Verlag Stroemfeld/Roter
Stern, Leipzig 1987, hier: Seite 428.] [X]
|
Zu ROBERT SCHUMANN ... und zu seinem Arzt
DR. MÜLLER alias WOLFGANG MÜLLER VON KÖNIGSWINTER.
Sommer 1852. ||| SEITE
270
Zunächst schien es ein rheumatisches Leiden zu sein, das ihm
namentlich nachts den Schlaf raubte und offenbar auch auf seinen
Gemüts zustand stark einwirkte. Nach vorübergehender
Besserung im Mai
trat Anfang Juni eine neue Verschlimmerung ein, die es ihm un
möglich machte, der ersten Aufführung des Manfred in Weimar
bei zuwohnen, was aber vielleicht ganz gut war, denn schwerlich
würde
er an der Lisztschen Anordnung, im Zwischenakt Richard Wagners
Faust=Ouvertüre spielen zu lassen, Geschmack gefunden haben. Ein
Erholungsaufenthalt am Rhein (vom 26. Juni bis zum 6. Juli)
in Godesberg, mit vielen Ausflügen ins Ahrtal und vor allem
ins Siebengebirge, schien bei einem wandellos schönen Sommerwetter
aufangs Stärkung und Frische bringen zu sollen. Aber gerade diese
beständig über dem Rheintal brütende blendende Hitze,
dazu offenbar
sehr unverständige Lebensweise (lange Wanderungen in der Sonnen
glut) steigerten das körperliche und seelische Unbehagen Schumanns
so sehr, daß er am 2. Juli auf einem Abendspaziergang am
Rheinufer nach Plittersdorf einen nervösen Krampfanfall bekam, der
sie
zum schleunigen Aufbruch und zur Rückkehr nach Düsseldorf
veranlaßte. Trübe Tage folgten. Zwar brachten
Rheinbäder, auf
Dr. Müllers Rat, wie in früherer Zeit
vorübergehend Besserung, aber
Ende des Monats verschlechterte sich sein Zustand wieder. „Robert
ist schrecklich heimgesucht von hypochondrischen Gedanken“,
schreibt
Clara am 21. Juli, „Dr. Müller
beruhigt mich übrigens ganz über
ihn, denn es sei nur ein Unwohlsein in Folge großer
Anstrengungen,
das sich aber nach und nach wieder verlieren werde. Jetzt ist es
aber im Steigen, denn es wird fast täglich schlimmer.“
In diese Zeit fiel das früher erwähnte
Sängerfest, und es er schien ausgeschlossen, daß Schumann,
wie er versprochen, in dem einen
Konzert würde dirigieren können. Am 30. Juli war die Probe,
in
der nach Verabredung Tausch Schumann vertreten sollte. „Wir
gingen aber doch am Abend hin, um wenigstens die
Cäsar=Ouvertüre
zu hören. Als aber Robert hörte, da ergriff ihn der
KomponistenSEITE 271enthusiasmus,
und er dirigierte sie selbst.“ Infolgedessen verschlimmerte sich
aber sein Befinden wieder so, daß er die aus Anlaß des
Festes zahlreich vorsprechenden Besucher nicht sehen und sprechen
konnte. Trotzdem ließ er sich für das Konzert am 3. August
den
Kommandostab nicht aus der Hand winden. „Robert nahm heute
alle seine Kräfte zusammen, aber mit größter Anstrengung*“,
schreibt
Clara, „dirigierte die beiden
Ouvertüren von Beethoven und seine
eigne.“
„Die nächste Zeit war eine recht traurige
für uns, denn mein
geliebter Robert litt viel und ich mit ihm. Dr. Müller
will uns
in ein Seebad oder Kaltwasseranstalt schicken. Meine Schwester
(Marie Wieck) können wir gar nicht unterhalten, denn ich verlasse
Robert nicht, und ihn greift jede Unterhaltung an**. Die nächsten
Tage verließ ich Robert wenig, endlich am 12. August faßten
wir
den Beschluß, nach Scheveningen ins Seebad zu gehen. Ich packte
unter mancherlei Kämpfen, denn Robert behauptete, die Reise nicht
machen zu können.“
Die Seebäder taten ihm entschieden gut; das
Tagebuch weiß
von fortgesetzter Besserung zu berichten, auch von Arbeitslust und
Freudigkeit. „Robert arbeitet
mit Heiterkeit an der Ballade“, schreibt
Clara am 5. September. Wenige Tage später sollte sie freilich ihm
einen großen Schreck bereiten durch eine vorzeitige Niederkunft,
die
offenbar durch die auf Anraten eines dortigen Arztes genommenen
Seebäder veranlaßt war. Trotzdem schritt die Besserung
vorwärts
und auch Clara erholte sich schnell und stand schon nach wenigen
Tagen wieder mit bewunderungswürdiger Frische und Tapferkeit auf
ihrem Posten.
Aber wenn sie auch erheblich leichtern Herzens Mitte September
wieder heimkehrten und dankbar die Behaglichkeit der in
ihrer [ES WÜRDE NUN TEXT VON DER NÄCHSTEN SEITE 272 FOLGEN,
K. J.]
___
*„Traurige
Ermattung meiner Kräfte“, notiert Schumann selbst am Morgen
des Tages.
**„Schwere
Leidenszeit“, notiert Schumann am 9. August.
:::
ES FOLGT NUN SEITE 272, aber
kein Dr. Müller alias Wolfgang Müller von Königswinter
wird mehr erwähnt. [X]
:::
[Alles zitiert nach Quelle G,
S. 270/271, mehrfarbig und teilweise fett/bold gemacht von K. J.] [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1852 ||| 30.7.1852 |
*
30.7.1852, Geburt von
Müller-Sohn Paul. Geboren in
Düsseldorf. Er wird aber bereits 1868, als Jugendlicher, in
Wiesbaden versterben. Paul Müller war zweites Kind und zweiter
Sohn des Ehepaars Müller (Wolfgang, bürgerlich: Wilhelm, und
Emilie).
Tod des Paul Müller am + 6.10.1868. Genaues Todesdatum laut
geni.com, hier: Daten des Thomas Föhl.
|
W. M. v. K. hatte
laut Buch Schrödl [Quelle E] 5 Kinder (3 Söhne, 2
Töchter): 1) Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4)
Else 1856–1933 5)
Tony 1857–1883 [X] Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich
der * 27.3.1856
als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1852 |
Müller hat (nach Bodendorf an der
Ahr)
später auch zu Neuenahr eine ganz besondere Verbindung. Die
bekannte Apollinaris-Quelle wird 1852 entdeckt, Beginn des
Aufstieges
zum "Bade Neuenahr", wo Müller 1873 sterben wird.
||| HINWEIS: Die Gemeinde Wadenheim, auch dazugehörig Hemmessen
und Beul, wurde offenbar erst 1875 in „Gemeinde Neuenahr“ umbenannt,
also nach dem Tod von W. M.
v. K. am + 29.6.1873.
|
Entdeckung der Apollinaris-Quelle in
Wadenheim, heute
Neuenahr, heute Bad Neuenahr, heute Bad Neuenahr-Ahrweiler. Neuenahr
ist offenbar aus dem "Kirchspiel" Wadenheim, zu welchem auch die
Dörfer Hemmessen und Beul gehörten, entstanden. |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1852 |
Julius
Roeting
erstellt ein Ölgemälde von W. M. v. K. – Julius
Amatus Roeting (* 13. September 1822 in Dresden | + 21. Mai ((evtl.
auch 22. Mai)) 1896 in
Düsseldorf) war ein deutscher Historien- und Porträtmaler. –
Das
Bild findet
sich schwarz-weiß gedruckt in Quelle B, Bd. 1, aufgeklebt auf der
Seite XII, das ist die erste Seite nach dem Verzeichnis der
Abbildungen. [X] Das "Klischee" für den Druck 1959 wurde erstellt
bei
Kaiser-Klischees Köln. |
Das Original des Bildes befindet sich
demnach im Kölnischen Stadtmuseum [Quelle B, Bd. 1, S. XI],
vermutlich im Depot. Das Museum, welches allerdings im März 2023
seine
neuen Räume in der Minoritenstr. 13 (direkte Nähe zum MAKK)
eröffnet. Wikipedia [W] hat eine lange Liste von
Roeting-Gemälden
erfasst, Quelle dafür ist aber unklar. Denn die Länge der
Liste lässt auf ein Werkverzeichnis schließen. Dort bei [W]
steht in
der Liste auch kurz: "Dr. Müller, Öl auf Leinwand,
133,5 cm × 97 cm, 1852". [X]
|
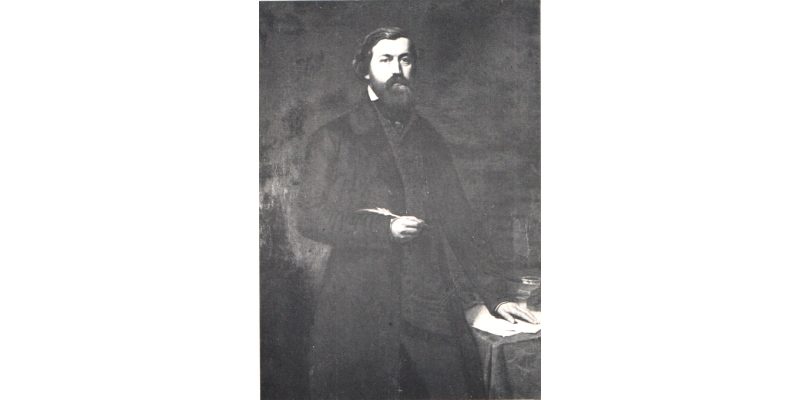
Besagtes
Gemälde, siehe auch den Text in der Tabellenzeile weiter oben,
erschaffen von dem Maler Julius Roeting. Roeting war u. a. bekannter
Portrait-Maler, (1822-1896). Er
hatte 1852 dieses Portrait von W. M. v. K. erschaffen, welches im
Besitz des Stadtmuseums Köln ist. Siehe
die schwarz-weiße und stark verkleinerte Bild-Kopie. Wir sehen
hier Wolfgang Müller von Koenigswinter
als "Dr. Müller" im Jahr 1852. Da hatte er, Müller, seinen
Wohnsitz noch in Düsseldorf, Roeting wurde Lehrender an der
Kunstakademie in Düsseldorf, soll aber laut [W] erst Ende der
1850er Jahre von Dresden nach Düsseldorf übergesiedelt sein.
Dr. Müller, Öl auf
Leinwand, 133,5 cm × 97 cm, 1852
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1852 |
Müller redigiert nun (wie bereits
1851) das 2. Düsseldorfer
Künstler-Album /Künstleralbum, also ein "Düsseldorfer
Künstler-Album".
Original-Schreibweise ist mit Bindestrich.[X]
Es erscheint 1852 in Düsseldorf. [X] (Es werden vom
"Düsseldorfer Künstler-Album" insgesamt 16 Alben, 1851 bis
1866, aber nicht an allen ist Müller beteiligt.) [X]
|
Siehe hierzu die ausführlichen
Informationen bei der Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen zu Wolfgang
Müller von Königswinter |

In dieser Ausgabe vom Samstag,
4.6.1853, stand
kurz und knapp, das Dr. Wolfgang Müller, alias W. M. v. K., nach
Köln umziehen wird. Siehe Eintrag 4.6.1853 auf dieser Web-Page
direkt hier unten. [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1853 ||| 4.6.1853 |
Vom
Umzug nach Köln weiß die "Bonner Zeitung" schon am 4.6.1853.
Sie berichtet auf Seite 1 (Titelseite) oben links in der Meldungsrubrik
"Deutschland"
kurz und knapp: "Der bekannte Dichter Dr. Wolfgang Müller zu
Düsseldorf wird nach Köln übersiedeln und sich als
praktischer Arzt niederlassen." [X]
|
_ |
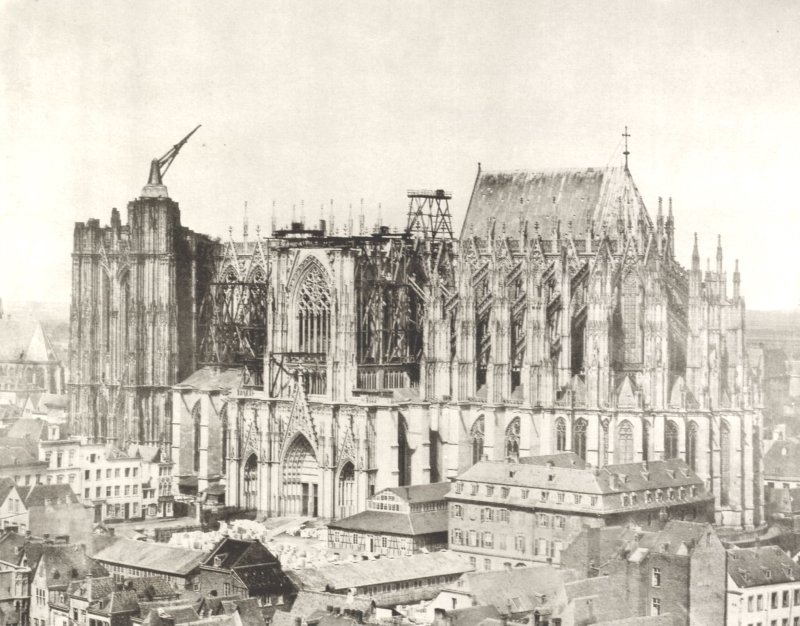
1853,
als W. M. v. K. nach Köln kam, dauerhaft, Wohnsitz, Umzug, da sah
der Kölner Dom so aus. Das Foto von Johann Franz Michiels
(1823–1977) zeigt
"Die Südseite des Kölner Domes". Bildquelle ist Wikimedia
Commons, zuvor Zeno. Hier der Direkt-Link zum Bild bei
[WMC]. Das Bild ist
gemeinfrei, public domain.  [X]
[X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1853 |
Umzug
der Familie Müller
samt Kindern (vermutlich den zwei bereits geborenen) nach Köln.
Offiziell hat W. M. v. K.
Düsseldorf am
16.7.1853 verlassen. [Quelle B, Bd. 2. S. 1]
Aber das vom
Schwiegervater angekaufte Haus in der Zeughausstraße 12 (??12??)
war noch nicht bezugsfertig. [Auch diese Info mit der Nummer 12 laut B,
Bd. 2, Seite 1,
aber Anmerkung K. J.: In den Adressbüchern Kölns wird (bis
zum nächsten Umzug innerhalb Kölns) immer
eine Hausnummer 14 für Müller und die Zeughausstraße
vermerkt sein. Keine 12!] [X]
Das "Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Köln",
Stück 41, Dienstag, 27.9.1853, vermeldet den Neuzugang von
W. M. v. K. in
der Stadt Köln (als Arzt) erst für den / im Herbst. (Siehe
Seite 327 des Jahresbandes.) Unter
"Personal-Chronik" steht: "Der
praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Wilhelm Müller hat
sich in Köln niedergelassen." [X]
|
Zwei Müller-Kinder waren da
bereits geboren: Max und Paul. Hans und Else und Tony werden erst nach
dem Umzug nach Köln geboren. [X]
W. M. v. K. hatte laut Buch Schrödl [Quelle
E] 5 Kinder (3 Söhne, 2 Töchter): 1)
Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4) Else 1856–1933 5)
Tony 1857–1883 [X] Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich
der * 27.3.1856
als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort.
|
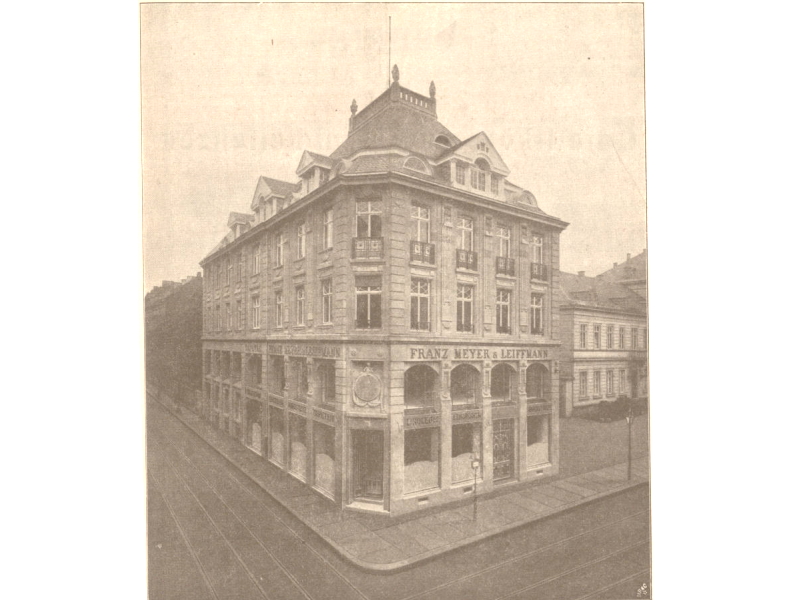
Hier
sehen wir einen Neubau aus der Kölner Zeughausstraße,
allerdings einige Jahrzehnte später, im Jahr
1905 oder kurz davor. Es handelt sich um die Zeughausstraße 10,
das Bild hat K. J. aus einer Werbeanzeige im [Adressbuch Köln
1905] herausgenommen und verkleinert. laut Werbung ein neubau. Es war
das Tapetengeschäft Franz Meyer und Leiffmann. Die Namen sieht man
an der Hausfassade. [X]
Müller aber zog 1853, rund 50 Jahre zuvor, in eben diese
Zeughausstraße. [X] Das Bild ist Public Domain.  Die
Zeughausstraße rund um den Römerturm sieht heute anders aus.
Direkt-Link
Zeughausstraße, Lage, Verlauf,
heutzutage ... bei OpenStreetMaps
Die
Zeughausstraße rund um den Römerturm sieht heute anders aus.
Direkt-Link
Zeughausstraße, Lage, Verlauf,
heutzutage ... bei OpenStreetMaps
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1853 ||| 29.7.1853 |
29.7.1853,
Müllers Abschiedsfeier in Düsseldorf, der "offizielle
Abschied". Er wohnt ja bereits in Köln.
Ein Artikel in der "Kölnischen Zeitung" vom 2.8.1853 trägt
den Titel "Wolfgang Müller's Abschied von Düsseldorf", ist
aber mit "Düsseldorf" und 29.7.1853 gezeichnet.
In diesem Artikel,der auf den Seiten 2 und 3 jeweils "unter dem Strich"
(Feuilletonstrich) steht, lesen wir am Anfang:
"Das Ereigniß der letzten Tage
war der Abschied Wolfgang Müller's, der, ungeachtet aller Bitten
und Vorstellungen seiner Freunde, von seinem, durch
Familien-Verhältnisse herbeigeführten, Entschlusse,
Düsseldorf mit Köln zu vertauschen, nicht abzubringen war.
Man hatte sich lange Zeit an den Gedanken, ihn zu verlieren, gar nicht
gewöhnen können, weil er so ganz und gar mit dem hiesigen
Kunstleben verwachsen, so zu sagen ein integrirender Theil desselben
geworden ist; denn Müller liebt das frische, ewig junge Leben der
heiteren Kunst neben seiner ernsten Heilkunst; er schöpfte aus dem
fröhlichen Künstlerleben stets neue Anregungen für eine
rastlose Muse; er gab ihre Geschenke und daneben die Früchte
seiner ernsten wissenschaftlichen Studien den Künstlern, seinen
Freunden, zurück. Wer eines Rathes in wissenschaftlichen
Angelegenheiten bedurfte, wendete sich an ihn; für das ganze
große Gebiet romantischer Historie war er, der die umfassendsten
Forschungen darin gemacht, die beste Quelle. Als die Freunde ihn baten,
seine Schätze wuchern zu lassen, sammelte er sie und hielt
Vorlesungen im „Malkasten“; da er stets den Gesichtspunct festhielt,
von welchem aus der darstellende Künstler die Geschichte und ihre
Poesie betrachten muß, so waren diese Vorträge für Alle
von unschätzbarem Werthe. Was aber noch besonders für seinen
Aufenthalt inmitten der hiefigen Künstler-Werkstätten ins
Gewicht fiel, das ist seine Stellung als Kritiker. Seit einem Decennium
war Müller der Vertreter unserer Kunstschule in der Presse; ein
festes Ziel vor Augen, leitete er die vielerlei Richtungen in eine
Bahn; unbeirrt von den mit einem solchen Streben nothwendig verbundenen
Widerwärtigkeiten, gab er dem einmal erkannten Guten sein Lob,
traf er mit wohlbegründetem Tadel die Verirrungen. Die letzten
zehn Jahre sind für die düsseldorfer Schule ein fortgesetzter
Kampf
um die höchsten Güter gewesen; [...]"
-- Artikel ist um Etliches länger, K. J. [X] (SIC!!!
düsseldorfer mit kleinem d.)
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1853 |
Reise
W. M. v. K. nach
Italien. Das
wissen wir u. a. aus den "Anmerkungen" des W. M. v. K. (Seite 185) zum
Buch "Der
Pilger in Italien. Sonette von Wolfgang Müller von
Königswinter. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1868." So der
Haupt-Innen-Titel des Buches. [X] W. M. v. K. schreibt dort "[...] ging
ich
über den Splügen, besuchte die norditalienischen Seen und
Mailand und kehrte über den Simplon zurück." [X] Seine zweite
Reise nach Italien war dann erst 1865.
::: NOCH EINE QUELLE:
Ab 12. August 1853,
Schweiz-Italien-Reise Ehepaar Müller ohne Kinder (diese
wurden
zuvor am 9.8. nach Bodendorf/Ahr gebracht) in die Schweiz, weiter bis
Mailand, wieder Schweiz [Quelle B, Bd. 2, Seite 1] bis 10. September
1853.
|
_ |
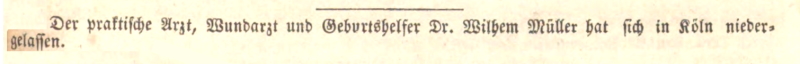
Das "Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Köln", Stück
41, Dienstag, 27.9.1853, vermeldet den Neuzugang in der Stadt
Köln. (Siehe Seite 327 des Jahresbandes.) Unter "Personal-Chronik"
steht kurz: "Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr.
Wilhelm Müller hat sich in Köln niedergelassen." [X] "Wilhelm
Müller" alias "Wolfgang Müller von Königswinter". [X]
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 16.10.1853 |
Müller arbeitet mit beim "Bremer
Sonntagsblatt". Das berichtet die "Kölnische Zeitung" kurz auf
Seite 3, Ausgabe Nr. 287, vom 16.10.1853. [X]
"Das Bremer Sonntagsblatt, redigirt
von D. F. Pletzer. Diese sorgsam redigirte belletristische
Wochenschrift empfiehlt sich durch Mannigfaltigkeit und Werth ihrer
Mittheilungen, kleine Erzählungen, Schilderungen, namentlich aus
dem norddeutschen Leben, poetische Beiträge, Berichte über
Literatur und Kunst, Correspondenzen u. s. w. Unter den Mitarbeitern
begegnen uns viele geschätzte Namen: Friedrich Gerstäcker,
Max Waldau, Wolfgang Müller, Nikolaus Delius, Al. Kaufmann,
Heinrich Smidt, Friedrich Bodenstedt, Louise v. Gall u. s. w. Wir
können das Bremer Sonntagsblatt allen empfehlen, die nach einer
feineren, anregenden Unterhaltung verlangen. Besondere Anerkennung
verdient noch, daß die Zeitschrift gegen das leidige Cliquenwesen
in der Literatur Front macht." [X]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1853 |
FRAGLICH: Redigierte Müller (wie
bereits 1851 und 1852) das 3.
Düsseldorfer Künstleralbum? Wir finden seinen nNmen
nicht: weder als Redakteur bzw. Herausgeber noch als Dichter.
"Düsseldorfer Künstler-Album". Original-Schreibweis mit
Bindestrich.[X]
Es erscheint 1853 in Düsseldorf. [X] WICHTIGER HINWEIS: Für
die Jahre 1854 bis 1859 wird dieses Düsseldorfer
Künstler-Album nicht
von Müller redigiert, und Texte scheinen von ihm auch nicht darin
zu sein. (EINZIGE DENKBARE AUSNAHME: Er publiziert 1853 oder 1854 bis
1859 unter einem uns unbekannten, ganz anderen Pseudonym).
Erst 1860 wird W. M. v. K. wieder als Herausgeber des
Düsseldorfer-Künstler-Albums in Erscheinung treten.
Vielleicht weil der Verleger 1860 dann gewechselt hatte: "Zehnter
Jahrgang. 1860. Düsseldorf. Druck und Verlag des lithographischen
Instituts von Levy Elkan, Bäumer & Comp. (vormals Arnz &
Comp.)"
|
Siehe hierzu die ausführlichen
Informationen bei der Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen zu Wolfgang
Müller von Königswinter. |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1854 |
In Köln,
da schreibt Müller an Max Waldau, und zwar im Februar 1854, quasi
als Neubürger noch, nach dem Umzug der Familie nach Köln
1853:
»Wenn man will, so kann man sich stets amüsieren. Und dieser
Sorte gehört denn auch meine Wenigkeit an.« [Quelle und
zitiert nach Kölnische Zeitung 6.11.1904.] [X]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1854 ||| 18.9.1854 |
*
18.9.1854, Geburt von
Müller-Sohn Hans. Drittes Kind, dritter Sohn. Geboren
wurde er am
18.9.1854 in Köln. (Name komplett: Hans Emil Felix Müller.)
Er taucht später selber auch noch in einem Literaturlexikon auf:
z. B. Brümmer, Franz, Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten
vom
Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Bd. 3., 6. Aufl. Leipzig
1913. Seite 59/60. [X]
Hans Müller nannte sich seit 1895 demnach "Hans Müller von
der Leppe", ahmte also den berühmten Vater per Pseudonym nach.
Er wird unter diesem Pseudonym 1895 das "Kronberger Liederbuch"
publizieren, ist 1889 Professor und Lehrer an der königlichen
Hochschule für Musik und wird 1894 zum
ersten ständigen Sekretär der Akademie der Künste
ernannt. (Er schreibt als Hans Müller das Buch "Die
königliche Akademie zu Berlin. 1696 bis 1896".) Er starb in
Berlin am 11. April 1897.
|
[Siehe
auch Quelle B, Bd. 2, Anmerkungen auf S. 394, Daten darin offenbar
entnommen
aus Quelle E, Seite 170.] [X] W. M. v. K. hatte laut dieser Quelle 5
Kinder (3 Söhne, 2 Töchter): 1)
Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4) Else
1856–1933
5)
Tony 1857–1883 [X] Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich
der * 27.3.1856
als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort. |
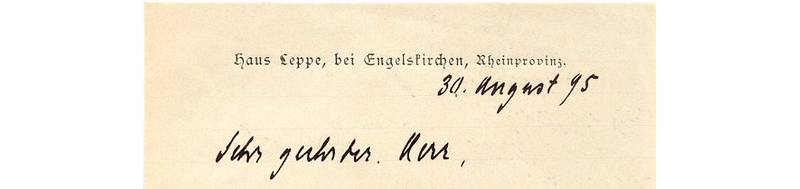
ACHTUNG:
Das ist die Handschrift von Sohn Hans Müller (1854–1897), nicht
von unserem W.
M.
v. K. selbst! Hans Müller (siehe hier oben auf dieser Website
beim Eintrag 18.9.1854,
Geburt des Hans) war der Sohn von Wolfgang Müller von
Königswinter. ||| Hans Müller, der sich später "Hans
Müller von der Leppe" nannte, schrieb noch 1895 aus dem "Haus
Leppe" (genauer: Haus Leppe 1) in Engelskirchen, gelegen eher noch in
der Nähe von Bickenbach, am
Fluss Leppe, ganz grob auch zwischen Lindlar und Ründeroth/Agger.
||| Wolfgang
Müller, der berühmte Schriftsteller und Vater von Hans, hatte
das großzügige Haus (man nennt es "Leppe 1", Postadresse,
das kleinere
Fachwerkwerkhaus hingegen "Leppe 2" ) 1871 erworben. Aber W. M. v. K.
starb ja bereits 1873. ||| Offenbar hat die Familie das Haus noch viele
Jahre lang
behalten, zumindest 1895 dürfte es also, so legt uns die Existenz
des Briefes nah, noch im
Familie-Müller-Besitz gewesen sein. [X] Der Brief (hier nur der
obere Teil von K. J. verkleinert dargestellt) wird/wurde von Kotte
Autographs, 87672 Rosshaupten, angeboten. [X] Zitat der Beschreibung
vom Autographen-Händler:
>>Hans Müller (1854–1897), Musikwissenschaftler. E. Brief
mit U. [Bickenbach], 30. August 1895. 1 S. auf Doppelblatt. Gr.-8°.
Mit e. adr. Kuvert. – An den Schriftsteller und Zeichner Georg
Bötticher (1849–1918) mit Dank „für die freundliche Zusendung
Ihres Aufsatzes über ‚Heinrich Heines Höllenfahrt’, den ich
bereits mit viel Freude gelesen hatte. Gegen eine neue Drucklegung
werde ich voraussichtlich nichts haben, sobald ich das ganze Buch noch
einmal durchgesehen habe [...]“. << [X] Das Buch über Heine,
um das in dem Brief geht, ist eines, welches W. M. v. K. einst
geschrieben hatte. Es war 1856 erschienen, allerdings anonym. [X] HAUS
LEPPE, im Bergischen Land, Open-Street-Map-Direkt-Link
zum HAUS LEPPE, Gutshaus mit Jugenstil-Elementen, gelegen 2 km nahe
zu/bei Engelskirchen. Offizielle Adresse "Haus Leppe 1, 51766
Engelskirchen".
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1855 ||| 28.4.1855 |
28.4.1855 als Ausstellungsdatum von
einem
Attest für W. M. v. K.
über die Entlassung aus dem Militärverhältnis.
(Ausgestellt in Berlin.)
[Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
Die
Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft plante schon länger eine
aber erst 1855-59 realisierte, feste Eisenbahnbrücke über den
Rhein. Zusammen mit der neuen Brücke wurde neben dem Dom auf dem
ehemaligen Gelände des botanischen Gartens der erste, für
alle Bahnlinien gemeinsame Kölner
Zentral-Personen-Bahnhof nach Entwurf des Architekten Hermann
Otto Pflaume gebaut. Dieser war ein kombinierter Kopf- und
Durchgangsbahnhof mit sechs Kopf- und zwei Durchgangsgleisen nach
Deutz. Die Bauzeit betrug vier Jahre, sodass der Bahnhof am 5. Dezember
1859 eröffnet wurde. [Siehe auch bei:
www.rheinische-industriekultur.com
Dort die Unter"site" zu Köln und dann konkret zum Hbf. Urquelle
dafür u. a. Ulrich Krings: Der Kölner Hauptbahnhof (=
Landeskonservator Rheinland, Arbeitsheft 22), Köln 1977]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1855 ||| 5.5.1855 |
Ausstellungsdatum für eine Mitteilung
der Entlassung
aus dem Militärverhältnis (für W. M. v. K.) durch den
Kommandeur des I. Bataillons des 28. Landwehr-Regimentes.
(Ausgestellt in Köln.)
[Quelle B, Bd. 2, S. 487]
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1855 ||| 4.10.1855 |
Im Beisein des preußischen
Königs
Friedrich Wilhelm IV. findet die feierliche Grundsteinlegung des
neuen Kunst-Museums Köln (heißt später dann
Wallraf-Richartz-Museum) auf dem Gelände des ehemaligen
Minoritenklosters (Kölner Hof) statt. (Erst am 1. Juli 1861 ist
dann die
Eröffnung des neuen Museums. Müller
wird später in einem Comitee
für die Entstehung des Museums mitarbeiten.)
|
_ |
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
1856 ||| 27.3.1856
|
*
Geburt der Tochter Else Müller (27.3.1856 in Köln) für W. M. v. K.
und seine Frau Emilie, geborene Schnitzler. Else ist das vierte Kind,
zugleich das erste Mädchen. [X]
Die Zahl 1856 taucht auch auf dem Grabstein eben dieser Else
Schrödl/Schroedl,
geb. Müller, in Frankfurt auf. Ihr Grab, auch das des
Ehemannes Norbert Schrödl/Schroedl ist auf "Gewann I", und
da Grabnummer 531. Hauptfriedhof Fankfurt. [X]
Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich der * 27.3.1856
als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort.
Else Schrödl, geb. Müller, stirbt am + 2.6.1933 in Frankfurt.
Auch laut
Grabgussplatte. [X] Siehe das Foto (Ausschnitt) direkt hier darunter.
|
W. M. v. K. (also bürgerlich immer
Wilhelm Müller) hatte mit Emilie Schnitzler später diese 5
Kinder (3 Söhne, 2 Töchter):
1) Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4) Else
1856–1933 5) Tony 1857–1883
[Siehe Quelle B, Bd. 2, Anmerkungen auf S. 394, Daten darin offenbar
entnommen aus Quelle E, Seite 170.] [X]
|

Ausschnitt
aus der Gussplatte vom Grab von Else Schrödl/Schroedl, geb.
Müller,
Tochter des Wolfgang Müller von Königswinter, laut Grabplatte
* 27.3.1856 | + 2.6.1933 ... und von Ehemann Norbert
Schrödl/Schroedl,
Maler, Städel-Professor, * 16.7.1842 | + 26.2.1912. Es ist Grab
531 in "Gewann I" auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Bild-Quelle:
Wikimedia Commons, hier der Direkt-Link zum Grab-Gesamt-Foto, gemacht von Udo Fedderies, im Jahr 2020.
Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich der *
27.3.1856
(sechsundfünfzig!) als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem
Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
1856 ||| 17.10.1856
und 18.10.1856 und 19.10.1856 und 20.10.1856
|
4-TÄGIGE EINWEIHUNG BAHNSTRECKE DEUTSCHLAND NIEDERLANDE. Müllers extra
getextetes "Festlied" wird dabei am 18.10.1856 in Deutz (bei Köln)
gesungen, bei der Einweihung der
durchgehenden Bahnverbindung Deutschland-Niederlande.
Auch in der "ALLGEMEINEN ZEITUNG" aus München, vom 23.10.1856,
finden
wir einen Artikel, der die ersten zwei Strophen aus Müllers
Eisenbahn-Gedicht zitiert [X]: "Köln, 19 Oct. [...]" [X]
Wir lesen aber bereits in der "Kölnischen Zeitung" vom 20.10.1856
den sehr
langen und ausführlichen Artikel (geschrieben schon 19.10.1856)
über die mehrtägige Bahn-Strecken-Einweihung mit der
Überschrift "Die Eröffnung
der Eisenbahn-Verbindung
zwischen Deutschland und den Niederlanden", laut welchem
Müllers
Text, der dort komplett, aber
noch ohne einen Titel, abgedruckt ist, als
"Festlied" gesungen wurde, bei der Einweihungszeremonie: "Darauf wurde dass folgende Festlied von
Wolfgang Müller mit Begeisterung gesungen [...]", ES FOLGT
DER TEXT, leider
lässt die Formulierung undeutlich, wer gesungen hat: Müller
selbst? Ein Chor? Alle Anwesenden? ((Thema: Mehrdeutige Sprache! K.
J.)) [X] [[ SIEHE DEN KOMPLETTEN
TEXT vom EISENBAHN-GEDICHT ...
KLICKEN... AUF EINER
WEITEREN WEB-PAGE ]] [X]
Ebenfalls in der KoeZei
vom 20.10.1856 lesen wir, hier vorab auf Seite 1 zu den
höherrangigen Gästen: "Köln, 19. Oct.
In Veranlassung der feierlichen Eröffnung der Eisenbahn-Verbindung
zwischen Deutschland und den Niederlanden [worüber wir unten
näher berichten] sind zu den hiesigen Festlichkeiten gestern unter
zahlreichen anderen Gästen eingetroffen die königlich
niederländischen Minister der Finanzen, Herr D. Vrolik, und des
Innern, Herr D. Simons, so wie der Chef der niederländischen
Wasserbauten, Herr van der Kun; ferner der General-Director der
königlich hannoverschen Eisenbahnen, Herr Hartmann, der Chef der
herzoglich braunschweigischen Eisenbahnen, Finanz-Director Herr v
Amsberg, der Ober-Präsident der Rheinprovinz, Herr v.
Kleist-Retzow 2c. 2c.(???) * Das königlich preußische
Ministerium
für Händel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten war
vertreten durch die Herren Minister v. d. Heydt, Excellenz,
General-Post-Director Schmückert, General-Bau-Director Mellin, die
Ministerialräthe Geh Ober-Finanzrath v. Viebahn, Geh.
Ober-Regierungsrath v. d. Reck, Geh. Ober-Regierungsrath Delbrück,
Geh. Baurath Hübener und Geh. Regierungsrath Wolf. Die meisten
Gäste widmeten den heutigen Tag theils der Besichtigung der
Merkwürdigkeiten unserer Stadt, theils einem Ausfluge nach dem
Siebengebirge, um Abends der gestern durch Nebel unmöglich
gewordenen, heute hoffentlich zur Ausführung kommenden
großen Rheinbeleuchtung beizuwohnen und sich morgen mit dem
Frühzuge zu dem Feste in Rotterdam zu begeben."
[X, * Das müsste "et cetera" bedeuten: jene Zeichen-Kombi
ähnlich wie 2c.2c. X]
Am 20.10.1856 sollte die offizielle Verkehrsübergabe sein, also
die Freigabe für den Alltagsverkehr, siehe dazu z. B. die Anzeige
der
Köln-Mindener Eisenbahn in der KoeZei vom 20.10.1856 betreffend
die sogenannte "Oberhausen-Arnheimer-Zweigbahn". [X]
|
HINTERGRUND: Am 18. Juli 1851
unterzeichneten die beiden Regierungen den
„preußisch-niederländischen Vertrag zum Bau der Eisenbahn
Oberhausen–Wesel–Emmerich–Arnheim“ .
SPÄTER: Das W. M. v. K.-Eisenbahn-Gedicht wird erneut
z. B. 1858 vom
Nicolaus Hocker in seiner poetischen Quellensammlung unter diesem
Gedicht-Titel
publiziert:
"Verbindung Deutschlands und Hollands
durch eine Eisenbahn", Seite 429
[[ SIEHE DEN KOMPLETTEN TEXT vom
EISENBAHN-GEDICHT ...
KLICKEN... AUF EINER
WEITEREN WEB-PAGE ]] [X]
HINWEIS: WIR LESEN AUCH IN DER
"ALLGEMEINEN ZEITUNG" aus München, vom 23.10.1856, einen
Artikel, der zumindest die ersten zwei Strophen aus Müllers
Eisenbahn-Gedicht
zitiert [X]:
"Köln, 19 Oct. [...] [[ SIEHE
DEN KOMPLETTEN ARTIKEL ...
KLICKEN... AUF EINER
WEITEREN WEB-PAGE ]] [X]
Das
Fest-Programm über vier Tage war kurzgefasst offenbar so:
17.10.1856 fuhr ein Festzug in Deutz (heute: Köln-Deutz) um 7 Uhr
nach Amsterdam ab. In Düsseldorf stiegen Ehrengäste noch
hinzu. In Ruhrort wechselte man aufs Boot. Das Boot hielt in Wesel, wo
wieder Leute zustiegen. In Emmerich dann aussteigen, dort viel los,
Wechsel wieder auf den Zug. Dann via Sevenaar, Arnheim, Utrecht, immer
mit Halt, nach Amsterdam. 17 Uhr Amsterdam, 18 Uhr Festdinner eben dort
im Königlichen Palast (Paleis op de Dam, vom Bahnhof heutzutage
binnen 5–7 Minuten zu Fuß zu erreichen.). 300 Gäste. (Aber
kein NL-König dort!) Reden. Ende gegen 22 Uhr. ||| Abfahrt
Amsterdam 8 Uhr morgens am 19.10.1856, nun Niederländer auch im
Zug, die mit nach Deutz kamen. Frühstück in Arnheim (D) =
Arnhem (NL).Gegen 16:30 Uhr wieder in Deutz.Festmahl mit Reden et al.
im "Hotel Bellevue" eben dort. Dort bei dieser Feier in diesem Hotel am
18.10.1856 auch Müllers Festlied! – Die NL-Gäste wurden zur
Sonntag-Freizeit (19.10.!) in Köln und Umgebung eingeladen. Abends
extra Feuerwerk für die Gäste. Festfahrt nach Rotterdam (!)
dann am 20.10.1856. (Siehe KoeZei vom 20.10.1856.) [X, das Programm
wurde aus dem sehr langen Zeitungsartikel grob von K. J.
"herausgefiltert."]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1856 ||| 19.10.1856 |
Es erscheint "Höllenfahrt
von Heinrich Heine", Hannover: Rümpler, 1856, 140 Seiten,
ANONYM veröffentlicht.
Es findet sich also nicht der Autorenname "Wolfgang Müller von
Königswinter" !!! Aber das Buch ist von ihm. Die "Kölnische
Zeitung" berichtet bereits am 19.10.1856 von dem Buch, bringt viele
Vers-Zitate daraus. Zitiert auch aus der "Ostdeutschen Post", Tenor des
KoeZei-Artikels insgesamt positiv: "[...] ein gereimtes Büchlein
erschienen, das in humoristischer Weise die deutsche Literatur der
neueren Zeit beleuchtet." [X]
|
Müller arbeitete
regelmäßig als Autor für diese zeitung bzw. konnte z.
B. Novellen abdrcuekn. Er dürfte die Redaktion informiert haben,
und das Buch dort abgegeben haben.
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1856 ||| 19.11.1856 |
Eine
Kommission in Köln verabschiedete am 19.
November 1856 einen Spendenaufruf zur Errichtung eines Denkmals zu
Ehren von Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Müller
wird im
Verlauf der Ereignisse um dieses Denkmal zum
"Ausführungskomitee" und zum noch engeren
"Verwaltungs-Ausschuß" gehören, eine Recherchereise nach
Berlin machen, die Ausschreibung für Entwürfe im Dezember
1860 mitunterzeichnen, die Aufstellung 1878 und Enthüllung am
26.9.1878 aber nicht mehr miterleben.
Er war dann schon fünf Jahre lang tot.
|
_ |

1857. Die Stadt Köln stimmt 1857 der
Idee eines Hauptbahnhofes (zuvor gab es verschiedene Bahnhöfe je
nach Fahrtrichtung, 1850 waren es fünf!) zu und stellt das
Gelände des ehemaligen Botanischen Gartens nördlich des Doms
und einen Teils der alten Universität zu Köln für den
neuen Zentralbahnhof zur Verfügung. Müller wohnt seit 1853 in
Köln, mit seiner Familie. Düsseldorf schlägt aber weiter
in seinem Herzen.
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
| 1857 ||| 14.1.1857 |
Verlagswerbeanzeige von
DuMont-Schauberg'sche Buchhandlung (also quasi eine
Verlagsbuchhandlung)
zu
2 Müller-Büchern.
|
1857 Zu/von W. M. v. K.s "Lorelei.
Rheinische Sagen" verkündet der
Verlag per Anzeige die bereits 3. Auflage. Verlag ist die
DuMont-Schauberg'sche Buchhandlung Köln. [Quelle: Kölnische
Zeitung 14.1.1857], vom "Rattenfänger" des W. M. v. K.
verkündet man zudem
die 2.
Auflage. [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte
|
1857 ||| 22.6.1857
|
Müllers
Projekt für die
Gründung des "Kölner Museumsvereins" läuft.
(Nicht zu
verwechseln mit dem Kölner Kunstverein! Dort war Müller der
Sekretär.)
"Wie wir hören, erfreut sich das durch Herrn D. Wolfgang
Müller ins Leben gerufene und von dem Vorstande und Ausschusse des
kölnischen Kunstvereins gutgeheißene Project der Bildung
eines Vereins zur Vermehrung der Kunstschätze des Museums
des
glücklichsten Fortganges."
[Quelle: Kölnische Zeitung 23.6.1857
per Datum 22.6.1857] [X]
|
1857 gilt als Gründungsjahr. 1929
kam es allerdings zu einer Fusion mit der Wallraf-Richartz-Gesellschaft
(von 1922) unter dem Namen "Freunde des Wallraf-Richartz-Museums".
Heute firmiert man als "Freunde des Wallraf-Richartz-Museums und des
Museums Ludwig e. V.", im Netz per Homepage kurz als
"kunstfreunde.koeln".
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1857 ||| 17.7.1857 |
"Für
Jacobis Garten". Ein Gedicht
von W. M.
v. K. über die Bedeutung des Jacobi'schen Gartens wird abgedruckt.
Siehe: "Kölnische
Zeitung", 17.7.1857. Titel-Seite. [X] Müller hatte das
Gedicht offenbar am 15.7.1857 in "Haus Drachenstein" geschrieben. [X]
Siehe zudem etliche Jahrzehnte später im:
"General-Anzeiger für Düsseldorf und Umgegend" Nr. 156 vom
7.6.1895). [Quelle F, S. 101] Das (heute, 2023 ff., noch existente)
Müller-Denkmal wird ja im Juni 1896 in Königswinter
eingeweiht. (Siehe zur Einweihung 1896 weiter unten in dieser
tabellarischen Biografe.)
Müller fordert am 17.7.1857 im Nach-Text ("Nachschrift") zum
Gedicht u. a. dazu auf: "Und warum
greift Ihr nicht ein, Ihr Künstler und Maler? Fertigt doch Bilder
an, welche die Kaufsumme aufwiegen, und dann spielt sie aus!"
[X] (Es geht um die Kaufsumme für den Ankauf und damit die Rettung
vom Jacobischen Garten.) "[...]; aber
sie dürfen diese Bäume nicht fällen, diese Rasen und
Grotten nicht zerstören, diesen Fluß nicht mit Rädern,
Färbereien und Wäschereien trüben." Müller
endet mit: "Rettet, rettet den
Jacobi'schen Garten !" [X]
Das Müller-Gedicht "Für
Jacobis Garten" wird dann 1896 anlässlich der
Denkmals-Einweihung für W. M. v. K. in Königswinter in der
Rhein- und Ruhr-Zeitung, 27.6.1896, erneut abgedruckt, komplett. [X]
Der Artikel-Autor weist darauf hin, dass dieses Müller-Gedicht
damals eine große Wirkung erzielte. Wolfgang Müller von
Königswinter wehrte
sich gegen eine mögliche Parzellierung des
Jacobischen/Jacobi'schen Gartens in Düsseldorf. Er war also eine
Art früher Kämpfer für naturschutzorientierte, sinnvolle
Städteplanung und gegen unnötige Zersiedelung. Ein
früher Umweltschützer von 1857!
ZITAT aus DEM Über-Müller-ARTIKEL von 1896: "Der
Erfolg des Gedichtes war so durchschlagend, daß die Parzellierung
und der Verkauf so lange verhindert werden konnten, bis ein Käufer
gefunden, mit dessen Wesenheit auch die Garantie für die der
litterarisch-historischen Bedeutung des Gartens entsprechenden
Erhaltung verbunden war."
UND: "Der Wunsch Wolfgang
Müllers, daß der Jacobische Garten als ein 'Denkmal'
erhalten bleibe, ist in der schönsten Weise in Erfüllung
gegangen; [...]" [X]
|
Siehe [W]: "In der Nähe von
Schloss Jägerhof lagen im 18.
Jahrhundert inmitten von Gärten auch einige Landhäuser, von
denen das Haus der Gebrüder Jacobi, als traditionsreiche
Begegnungsstätte für Künstler und Philosophen, einen
bedeutenden Ruf besaß."
Heute sind diese Gärten vielleicht eher als
"Malkastenpark" bekannt. Der „Malkasten Künstlerverein“ von 1848,
Müller war als Nichtmaler Mitglied (!), erwarb das
schließlich das Jacobi-Gut und rettete so den Jacobigarten vor
der geplanten Bebauung, heute ist das Gelände also die Parkanlage
des berühmten
Düsseldorfer Künstlervereins Malkasten.
ADRESSE HEUTE: Jacobistraße 6,
40211 Düsseldorf (Pempelfort).
Open-Street-Map-Direkt-Link zum
Jacobipark alias Malkastenpark heute.
Es gab 1857 die Verkaufsverhandlungen zum
Erwerb des Jacobi'schen Gartens, bezüglich der Düsseldorfer
Künstlervereinigung "Malkasten".
17.9.1857: Achenbach und v. Sybel sind
formell die Käufer gewesen. ||| Es gab einen Vertrag, durch den F.
W. J. Brewer das Jacobi 'sche Gut, bestehend aus Wohng
bäude, Remisen, Stallungen, Scheune, Schuppen, Parkanlage mit
Orangeriehaus,
Weiher, Gemüse- und Obstgarten, insgesamt 11 Morgen 117 Ruthen,
vierzig
Fuß, für die Summe von 22.000 Thlr. an A. Achenbach und A. v
. Sybel
verkauft, 17. 9. 1857 (Urkunde)
[Quelle H, Seite 102] [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1857 ||| 27.9.1857 |
*
Geburt Antonie bzw. Antonia bzw. Tony Müller, weitere Vornamen
Johanna
Emilie (= Vornamen
von Oma und von Mutter). Also *
Geburt von
W. M. v. K.s Tochter
"Tony" ... als Kind Nummer 5
für Wolfgang und Ehefrau Emilie. [Siehe
Quelle B, Bd. 2, Anmerkungen auf S. 394, Daten offenbar entnommen
Quelle E, Seite 170.]
W. M. v. K. (also bürgerlich immer
Wilhelm Müller) hatte mit Emilie Schnitzler diese 5
Kinder (3 Söhne, 2 Töchter):
1) Max 1850–1908, 2) Paul 1852–1868 3) Hans 1854–1897 4) Else
1856–1933 5) Tony 1857–1883
[Siehe Quelle B, Bd. 2, Anmerkungen auf S. 394, Daten darin offenbar
entnommen aus Quelle E, Seite 170.] [X]
Laut Buchquelle B-aus-E wurde Tonys Schwester Else 1856 geboren.
[X] Siehe auf dieser Webpage weiter oben bei diesem Datum für
Schwester Else. Zu Else (verheiratet zu Schrödl) findet sich der *
27.3.1856
als Geburtsdatum auf ihrer Grabplatte in dem Monumentalgrab, super
hoch!, auf dem Hauptfriedhof Frankfurt. [X] Von K. J. selber dort am
14.9.2023 gecheckt, vor Ort.
Tony wird am + 29.1.1883 in Frankfurt am Main sterben, Siehe z. B. die
Daten im Brentano-Stammbaum,
hier: Ahnentafel zu Emil Georg (von) Brentano bei
www.einegrossefamile.de, Betreiber der Homepage ist Reinhard
von Goetze. Siehe aber auch die Daten auf der Grabplatte, die K.
J. am 14.9.2023 vor Ort in F. a. M.checkte. Siehe auch bei DIREKTLINK
zu "Einige Personen zu und um Wolfgang Müller von
Königswinter".
Das Ehepaar ⚭ Tony/Emil wird offenbar nur einen Sohn haben: Franz
Brentano, *
Geburt am
1.6.1882 in Winkel, heute heißt der Ort Oestrich-Winkel.
|
Tony heiratete ⚭ demnach später
einen Erich (???) Brentano, gemeint ist wohl Emil, ⚭ HOCHZEIT 4.8.1881,
KÖLN,
(Quelle. Kölnische Zeitung, 5.8.1881, dort gedruckt der Civilstand
der Stadt Köln zum/vom 4.8.1881. [X]) Tony lebte in
Winkel am Rhein und starb bereits + am 29.1.1883. ||| Der Ehemann war
wohl EMIL GEORG von BRENTANO (1845–1890), kein Erich. [X] ||| W. M. v.
K.
wird ja Jahre später "Das Haus
der Brentano" publizieren – über seine Tochter
Tony bekam er bis 1873 (sein Tod!) vielleicht noch Kenntnisse aus
erster Hand. Das Haus der Brentano,
Romanchronik, erschien als Fortsetzungsserie in Hackländer’s
Deutscher Romanbibliothek 1874. (Diese war eine Beilage zur Zeitschrift
"Über Land und Meer".) In 1874, Band 2 (also: 2. Jahrgang),
wiederzufinden.
Alle Teile der Serie. [X]
|
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| 1858 ||| 28.1.1858 |
W. M.
v. K.
taucht am 28.1.1858 in der Kölnischen Zeitung
als Schriftführer des Kölner Kunstvereins auf.
Er
vermeldet
zum (vergangenen) Stichtag 12.1.1858 als "heute", dass Dr. (man schrieb
damals immer nur D.) Wilhelm Hemsen neuer
Geschäftsführer ist. Als Nachfolger von Herrn J. B. Tosetti.
[X] ||| Meldung/Anzeige ist aber auch zu finden in der Kölnischen
Zeitung vom
30.1.1858. [X]
|
EINEN TAG ZUVOR: Abdruck des
Langgedichtes "Karl Freiherr vom Stein", auf der Titelseite der
Kölnischen Zeitung 27.1.1858, Nr. 27, geschrieben von "Wolfgang
Müller von Königswinter", so der Name komplett hier
abgedruckt. Gedichtanfang erste Zeile: "Den besten Mann gab dort das
Thal der Lahn, [...]", eine Fußnote besagt: "Aus der neuen
Bearbeitung der 'Rheinfahrt'". [X]
|
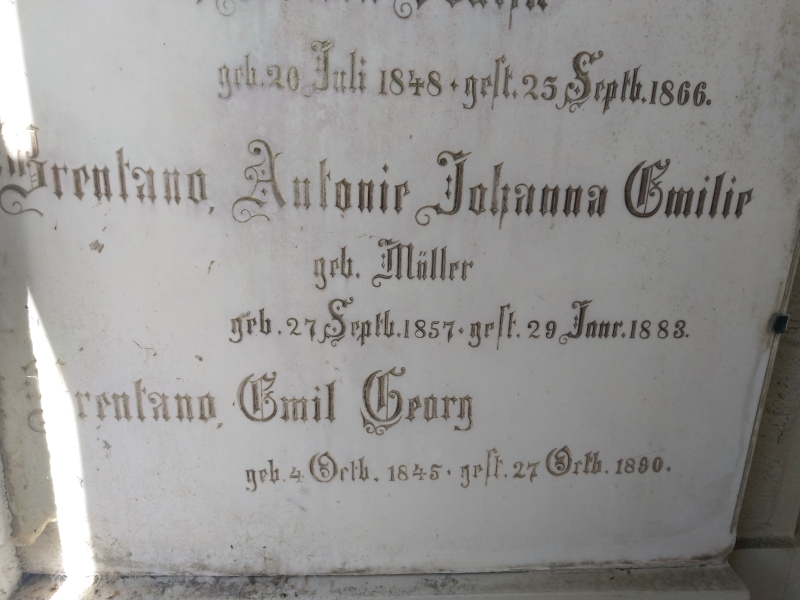
Wir
sehen die Grabplatte zu der W. M. v. K.-Tochter Antonie Johanna Emilie
Brentano und ihrem Ehemann, Emil Georg Brentano, auf dem Hauptfriedhof
Frankfurt am Main. Das Foto wurde von K. J. am 14.9.2023 gemacht. Es
handelt sich hier um den auffälligen Gruftenbau (Gruftenhalle) im
"Gruftenweg" (ja, auch wichtige Wege auf dem Friedhof tragen einen
Namen!) auf dem Friedhof, ein langer Querriegel quasi. Es gibt einen
Friedhofseingang, der "Eingang Gruftenweg" heißt. Der Eingang
liegt auf der Rat-Beil-Straße. [X] In diesem langen
Bau-"Riegel" finden sich etliche Grabstellen/Gruften, wie in/unter
einer
Wandelhalle, viele davon aber über die Jahrhunderte zerstört
oder beschädigt. Die Grabstelle der Brentanos mit etlichen Namen
findet sich bei Grabstelle 48 in eben dieser Gruftenhalle. Seitlich an
den Säulen befinden sich bei einigen Grabstellen auch noch weitere
Platten
mit Namen, die Zahl der bestatteten Famlienmitglieder wurde immer
größer, der Platz bisweilen knapp. So auch bei den
Brentanos. Diese
Platte vom Foto hier ist seitlich
vorne links zu finden. Und wir befinden uns bei Antonie und Emil Georg
schon
ganz unten am Fußboden. [X] ||| Direkt-Link zur Lage der
Gruftenhalle bei der Karte Open Street Map (openstreetmap) mit den Koordinaten
50.13292/8.69131 |||

This file is licensed under the Attribution-Share
Alike 4.0 International license. (CC BY-SA 4.0) Das von Klaus
Jans gemachte Foto hier oben kann also problemlos und leicht unter
Berücksichtung der Hinweise in der hier deutschsprachigen Lizenz
genutzt werden. K. J. ||| 

DIREKT-LINK ©
OSM-Mitwirkende ... für die Karte, wo das Denkmal mit dem Pfeil
markiert ist.








::::::::::::
::::::::::::
Hier:
ENDE TEIL 1
bis 29.1.1858, weiter
geht es mit TEIL 2.
DIREKT-LINK
zu TEIL 2,
nun ff. ab 30.1.1858
TABELLARISCHE
BIOGRAFIE
Zeitleiste von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter = W. M.
v. K.
BIOGRAPHIE Biografie,
TABELLARISCH als
ZEITLEISTE
Hier folgen diejenigen Quellen,
wenn die
Buchstabenkürzel dann weiter oben in den Informationen
wiederzufinden
sind. Viele Quellen wurden weiter oben auch schon direkt zum Datum
bereits angegeben ... wie als Beispiel "Kölnische Zeitung", diese
aber
auch als "KoeZei" mal verkürzt.
A =
www.bad-neuenahr-ahrweiler.de/wolfgangmueller
Adressbuch Köln 1905
= "Greven's Adreßbuch für Köln und
Umgebung insbesondere auch Mülheim am Rhein und Kalk". "Nebst
Stadt- und Theaterplänen." "Einundfünzigster Jahrgang"
"Redigiert und herausgegeben von Ant. Carl Greven."
"Verlag von Greven's Kölner Adreßbuch-Verlag Ant. Carl
Greven" "Druck durch Greven & Bechtold, Köln,
Brückenstraße 6."
Jahrgang/Auflage: 51.
Erscheinungsjahr: 1905. [X]
B =
Luchtenberg,
Paul
(1959):
Wolfgang
Müller von
Königswinter. 2 Bände. Köln: Verlag Der Löwe, Dr.
Hans Reykers (Veröffentlichungen des Kölnischen
Geschichtsvereins e. V., 21).
C =
Historisches
Archiv
der
Stadt
Köln, Eifelwall 5, 50674
Köln. Der Müller-Bestand hat die Verzeichnis-Nummer 1141.
D =
Herausgeberinnen-Informationen (und zwar von Herausgeberin
Sabine
Graumann)
auf circa 29 Seiten zum Vater (von W. M. v. K.) Müller und zur
Familie
Müller, in:
__||| Johann Georg Müller,
Der Kreis
Bergheim um 1827, Preußische Bestandsaufnahme des Landes und
seiner Bevölkerung, bearbeitet von Sabine Graumann, Köln
2006, Verlag Böhlau (Köln Weimar Wien), Studien zur
Geschichte an Rhein und Erft 1.1,
Rhein-Erft-Kreis-Veröffentlichungen, Medizinische Topographien
zwischen Rhein und Erft.
Anfang des Buches (mit den Kern-Infos zur Familie Müller) ist so:
VORWORT
A. Der Autor Georg Müller (Seite
1)
1. Jugend in Mülheim am Rhein und
Studium in Duisburg (Seite 1)
2. Die Doktorarbeit: "De vi naturae
medicatrice" (Seite 6)
3. Arzt in Euskirchen und
Kreisphysikus in Königswinter (Seite 8)
4. Kreisphysikus in Bergheim (Seite 10)
5. Arzt in Düsseldorf (Seite 28)
... es geht dann weiter mit B.: Die Medizinische Ortsbeschreibung, ab
Seite 30 [X]
____||| HINWEIS K. J.: W. M. v. K.s Vater, jener Arzt Johann Georg
Müller, hatte als Georg Müller bereits 1814 eine raisonirende
"Topographie des Cantons Königswinter von Docktor Georg
Müller [...]" vorgelegt. Siehe
in: Vom Amt Wolkenburg zum
Canton Königswinter zwischen dem Breitenbacher Graben und der
Siegmündung / von Winfried Biesing
Topographie des Cantons
Königswinter von Docktor Georg Müller Physicus des Cantons
und pracktischem Arzte daselbst November 1814, transkribiert von
Manfred van Rey. [Beides in einem Gesamtwerk/-buch von 64 Seiten],
hrsg.
vom Heimatverein Siebengebirge e. V., Königswinter, Juni 1984.
Gesamtherstellung: Druckerei Plump KG, 5342 Rheinbach. (Postleitzahl
heute wäre 53619.) ||| Der Müller-Bericht über den
Canton Königswinter findet sich auf den Seiten 37–62. [X] In
(Johann)
Georg Müllers Handschrift (Original im Stadtarchiv Bonn) von 1814
waren es
offenbar 48 Seiten.
DüZei = Düsseldorfer Zeitung
E = Norbert
Schrödl,
Ein
Künstlerleben im Sonnenschein,
hrsg. von Else Schrödl geb. Müller, Tochter des Wolfgang
Müller von Königswinter, Frankfurt 1922, (= Frankfurter
Lebensbilder 5).
F =
Soénius,
Ulrich
S.,
"Schnitzler" in: Neue Deutsche
Biographie 23 (2007), S. 332-333 [Online-Version]; URL:
https://www.deutsche-biographie.de/pnd139804749.html#ndbcontent
G = Clara
Schumann.
Ein
Künstlerleben. Nach
Tagebüchern
und Briefen. Von
Berthold Litzmann
[erfasst von Barbara Koch], hier die sechste Auflage/Ausgabe für
Band 2 in 1920, es sind zusammen drei Bände. Verlegt von Breitkopf
& Härtel in Leipzig, (1902 gab es bereits eine 1. Auflage zu
Band 1.) ||| Konkret:
Zweiter Band Ehejahre 1840-1856, Leipzig 1920, Drittes Kapitel:
Herbstfäden (1850-54). Dieses 3. Kapitel beginnt auf im zweiten
Band auf Seite 223.
H
=
QUELLEN ZUR
GESCHICHTE
DES
KÜNSTLERVEREINS MALKASTEN
Ein Zentrum bürgerlicher Kunst und Kultur in Düsseldorf
seit 1848,
bearbeitet von Sabine Schroyen
in Verbindung mit Hans-Werner Langbrandtner. 1992
Rheinland-Verlag GmbH · Köln
in Kommission bei
Dr. Rudolf Habelt GmbH – Bonn
I = Baur, Uwe, Queen Victorias
Rheinreise anno 1845 im Spiegel der
internationalen Presse, in: Internetportal Rheinische Geschichte,
abgerufen unter: https://rheinische-geschichte.lvr.de
:::
Epochen-und-Themen/Themen/queen-victorias-rheinreise-anno-1845-im-spiegel-der-internationalen-presseDE-2086/lido/57d12cabcf5ef5.70298481
(abgerufen am 07.12.2022)
J = Angaben von Thomas Föhl auf
geni.com
K = Becker, Wally, Erinnerungen aus
meinem Leben, (evtl. publiziert
unter dem Namen
Valerie Becker), Verlag Deitz (eventuell auch als Verlag Lüder
Deitz),
Frankfurt am Main, 1901, 247 Seiten. ||| Eine andere, frühere
Auflage wäre möglicherweise von 1891, verlegt bei Honsack,
mit 196 Seiten. Erinnerungen aus meinem Leben : für meine Kinder
und
Enkel / Wally Becker ||| (Wally Becker war die Schwester des W. M. v.
K.,
er selber schrieb
[gedruckt] allerdings Walli mit i als Widmung zu diesem Buch. "Zum
stillen
Vergnügen. Künstlergeschichten", Verlag Brockhaus, 2
Bände, 1865. Dort steht "An meine lieben
Geschwister, Walli, Eduard und August." [X] Das wurde als Widmung ins
Buch gedruckt.
(Der Maler Jakob Becker "von Worms" war Ehemann der Wally Becker und
Schwager des W. M. v. K.)
KoeZei =
Kölnische
Zeitung
L = Dr. M. [[ = realiter unser W.
M.
v. K.! ]], Erinnerungen an Norbert
Burgmüller, In: Neue Zeitschrift für Musik. 1840 – Der Text
zu NORBERT BURGMÜLLER ist gestreut über einige Ausgaben in
NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK
1840, beginnend in Ausgabe No 1, 1. Januar 1840 auf Seite 1 (davon ein
Teil der Seite), Seite 2, Seite 3. Ende der Artikelserie in No 12, 7.
Februar 1840. [X]
M = "Löblich wird ein tolles
Streben, Wenn es kurz ist und mit
Sinn" – KARNEVAL IN KÖLN, DÜSSELDORF UND AACHEN
1823–1914 Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde
vorgelegt der Philosophischen Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn von
Christina Frohn aus Eschweiler (Kreis Aachen)
Bonn 1999.
N = Allgemeine Deutsche Biographie,
kurz: ADB, hier der Eintrag zu
Wolfgang Müller von Königswinter, Band 22 (1885), S. 698–701.
Leider steht in der ADB das falsche Geburtsdatum 15.3.1816, real war es
aber der 5.3.1816. Solche Fehler setzten sich dann über
Jahrhunderte fort. Bis hin zum Eintrag bei Wikipedia.
| Der ADB-Beitrag stammt von Franz Brümmer. Er fußt
offenbar
...
1. auf Kölnische
Zeitung vom 5.7.1873 |||
2. auf Ignaz Hub:
Deutschlands
Balladen- und Romanzendichter, 3 Bände, S. 263 (also
vermutlich
so: Deutschlands Balladen- und Romanzendichter von G. A. Bürger
bis auf die neueste Zeit, 3 Bände, Karlsruhe 1845 ff. UND ES GIBT
OFFENBAR WEITERE AUFLAGEN, z. B.: Dritte, mit Nachträgen stark
vermehrte Auflage. Erschienen 1860. [X] |
3. auf Kurz:
Geschichte der deutschen Literatur, 4 Bände, Seite
184 und
Seite 394 (HINWEIS: In Kurz, Band 4, hier Ausgabe 1874, [[ Geschichte
der deutschen Literatur: mit ausgewählten Stücken aus den
Werken der vorzüglichsten Schriftsteller / 4: Geschichte der
neuesten deutschen Literatur von 1830 bis auf die Gegenwart
3., unveränd. Aufl. - Leipzig : Teubner, 1874. - XIII, 983 S. ]]
steht auf
Seite 184 das richtige Müller-Geburtsdatum: 5.3.1816 !!!! [X]
VERMUTLICH ALSO LAUTET DER HAUPT-TITEL LANG ALSO für jeden Band
SO:
Geschichte der deutschen Literatur
mit ausgewählten Stücken aus den Werken der
vorzüglichsten Schriftsteller, man findet auch Texte von
Müller darin, zum Beispiel "Hast du von den Fischerkindern", Band
4, S. 186, oder "Mein Herz ist am Rheine", Band 4, S. 185. ( ES SIND
ALLEIN BEI "LYRISCHE POESIE": 1. Mein Herz ist am
Rheine 2. Hast du von den Fischerkindern 3. Stille . 4. Glückliche
Liebe 5. Wenn dir blond die Locken fliegen 6. Sommersegen, (Siehe
genauer
bei 1874 bei Publikationen
zu/für/von Wolfgang Müller von Königswinter )
[X]
auch da mehrere Auflagen, z. B. Leipzig, Verlag Teubner, 1865, oder
eine 3. unveränderte Auflage, Leipzig, Teubner, 1875. [X]) |||
4. auf Johann
Minckwitz: Der neuhochdeutsche
Parnaß,
Seite 600 | K. J. sagt: Vermutlich ist gemeint: "Der neuhochdeutsche
Parnaß. 1740 bis 1860. Eine Grundlage zum besseren
Verständnis
unserer Litteraturgeschichte in Biographien, Charakteristiken und
Beispielen unserer vorzüglichster Dichter von Johannes Minckwitz.
Mit Portraits in Holzschnitten. Leipzig, Arnoldische Buchhandlung.
1861." [X] |||
___||| zu Brümmer: Karl Wilhelm Franz
Brümmer (* 17.
November 1836 in Wusterhausen [Dosse] | + 30. Januar 1923 in
München) ___||| zu Kurz: Heinrich Kurz (* 28. April 1805 in
Paris |
+ 24. Februar 1873 in Aarau) ___||| zu Minckwitz, vermutlich ist es
dieser: Johannes Minckwitz (* 21. Januar 1812 in Lückersdorf,
Oberlausitz | + 29. Dezember 1885 in Neuenheim bei Heidelberg)
HINWEIS:
Müller ist allerdings mit dem
richtigen Geburtsdatum 5.3.1816 in
einem Franz-Brümmer-Lexikon erfasst. [X] ALLERDINGS: 6. Auflage.
Brümmer, Franz: Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom
Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Bd. 5. 6. Aufl. Leipzig,
1913. Autor/in: Franz Brümmer,
Erscheinungsjahr: 1913 Verlag/Drucker: Reclam, Ort: Leipzig, Band:
Fünfter Band. Minuth bis Risch (Bd. 5 von 8), Auflage: Sechste
völlig neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage.
O =
Walther
Ottendorff-Simrock: "Als schönste Erinnerung bleibt mir dies
prächtige Ahrtal..." - Wolfgang Müller in Bodendorf und Bad
Neuenahr, in: Heimatjahrbuch für den Kreis Ahrweiler 1962.
P =
Jakob
Rausch: Der Name Neuenahr in geschichtlicher Schau, in: Heimatjahrbuch
für den Kreis Ahrweiler 1958.
Q =
Geschichte des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen
1829-1929, zur Feier des hundertjährigen Bestehens des
Kunstvereins, Dr. Kurt Karl Eberlein, Verlag des Kunstvereins für
die Rheinlande und Westfalen, DÜSSELDORF 1929, SCHRIFTEN DES
STÄDTISCHEN KUNSTMUSEUMS DÜSSELDORF, BAND III
R =
"Wolfgang Müller von
Königswinter. Arzt und Schriftsteller (1816-1873)", von
Pia Heckes (Bonn), in: Internetportal Rheinische Geschichte,
www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/wolfgang-mueller-von-koenigswinter/DE-2086/lido/57c9516754ab31.17301722
abgerufen z. B. am 15.4.2023
S = Schumann-Tagebücher, Bd. 2
für 1836–1854, hrsg. von Gerd
Nauhaus, 756 S., Verlag Stroemfeld/Roter Stern, Leipzig 1987
W oder [W]
=
Wikipedia. Insbesondere dann, wenn man die Ur-Quelle der
Wikipedia-Information nicht erschließen kann, kann man nur noch
ein am Ende ungenaues [W] angeben. Die Qualität
der Wikipedia-Einträge ist sehr unterschiedlich, gerade auch
bezogen auf solche Ur-Quellenangaben. Grundfrage ist immer: Woher kommt
die Information?
[X] = Angaben
und
Informationen
und Daten etc., die Klaus Jans
als
Ersteller dieser tabellarischen
Biografie A) selber nun neu erschlossen und nachgeguckt hat ... oder B)
bisweilen
extra
nochmals gecheckt hat ... und so dem
Wolfgang-Müller-von-Königswinter-Kontext hinzufügte ...
und
bei denen er für die Echtheit der Angabe qua Person einsteht.
W.M.v.K. = W. M. v. K. (Rechtschreibkommission
und
der
DUDEN
würden eine Schreibung mit Leerstellen wünschen.)
Weitere Quellen, die weiter oben in der tabellarischen Biografie
auftauchen.








::::::::::::
::::::::::::
| Jahr | evtl. Datum |
Ereignisse
Müller (W. M. v. K.) |
Publikationen
Müller UND/ODER Was ringsum
passierte |
| _ |
_ |
_ |
::::::::::::
::::::::::::
::::::::::::

Mögliche Quellenangabe
KURZ:
Klaus Jans,
Tabellarische
Zeitleisten-Biografie zu Wolfgang Müller von Königswinter,
www.klausjans.de/liste-buecher-publikationen-veroeffentlichungen-zu-wolfgang-mueller-von-koenigswinter.htm
[[ plus:
TAGESDATUM
DES
ABRUFES dieser HOMEPAGE-SEITE/SITE ]]
LANG:
Klaus
Jans, Biographie, Biografie, tabellarisch als
Zeitleiste,
zu und
für
Wolfgang Müller von
Königswinter,
* 5.3.1816, + 29.6.1873, W. M. v. K.,
[[ plus TAGESDATUM
DES
ABRUFES dieser HOMEPAGE-SEITE/SITE ]]
HOME
||| Siehe auch Liste
Bücher Publikationen Veröffentlichungen
zu Müller.
Siehe auch die bislang bekannten Briefe an
und von Wolfgang Müller von
Königswinter.
Siehe auch Müller-Gedicht-Vertonungen.
Alphabetische
Titelliste der Gedichte Texte Buchtitel
et al. Wolfgang
Müller von Königswinter







IMPRESSUM
||| DATENSCHUTZERKLÄRUNG
||| Sitemap
HOME






HOME
= index.html | | | Sitemap
Goethe
alias die Leiden des jungen
Werthers in der globalisierten Welt
5
AUDIO-CDS u 1 E-BOOK Deutsch so einfach – Hören
Sprechen Üben
Interessante
Details über Shona (Schona) – eine Bantusprache in Simbabwe
(Zimbabwe)
Die
Anfänge des Tagesspiegels
ODER Die Anfänge der Tageszeitung
"DER TAGESSPIEGEL" von 1945
bis zum Frühjahr 1946 in Berlin
Yoffz der Trainer spricht
zum morgigen
K.o.-Spiel
Bilder aus China Teil I und II von 1877 ||| Junge Lieder

Die
paar Hundert Absahner | Der zornig-ironische Essay über den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Platzierung und
Vermarktung von Büchern aus Großverlagen/Verlagsketten,
gerade in den Talkshows. | Aber auch in anderen Sendeformaten. Die
paar Hundert Absahner |

Abkehr
| Bücher
| Zu den
Radionachrichten | Ergo Ego | HOME
| Radiophile
Untertöne |
Oh
Ehrenbreitstein | Zur
Physiologie des Kusses | Mixtur
| Essay
über Köln |
Lob der
Landcruiser |
Der Essay
zum Thema #Aufschreiben |
Der ewig
herrliche Trend KURZPROSA-GEDICHT | Kurzprosa INTERESSEN |
Kurzprosa "Ein Leichtathletik-Trainer spricht" |
Kurzprosa vom Briefmarkenbeaufragten NEUES AUS DEM BEAUFTRAGTEN-PORTOWESEN |
Die
Rollladenverordnung -- Oh ... Welt
bürokratischer Tücken -- |
Das
Ärgernis POSTBANK und zudem die Lächerlichkeit ihrer
KI-Kunden-Beantwortungsmaschinerie |
Offener Brief an die Geschäftsführung vom VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH), wegen der erneuerten VRS-App (als Anlass).
Das
unerträgliche Kommentatoren-Gesabbel bei
Fernseh-Fußball-Spielen |
Glaube,
Liebe, Hoffnung – ein Essay über Religion
| Deutsch
lernen im Internet-Zeitalter |
DDRkundungen.
Beobachtungen aus dem Jahr 1990 | STADTGARTEN
9, Krefeld | STADTGARTEN
12, Krefeld |
Ein ganz
kurzer Sprach-Essay |
Essay
über Trier | Wonderful
Schönsprech |
Christian Lindner spricht wie sein eigener Klon | Auch noch ein Essay
|
Der
Verleger Ernst Röhre in Krefeld |
Die
Tragik von etlichen Wirtschaft(s)- und Zahlen-Artikeln | Doppel-Wort-Liste / Doppelwort: Man
verliest sich |
Häresie
im Traumland. Gedanken über das
Goethe-Institut |

Die Familie Bermbach, hier in der Linie
Camberg Wiesbaden Köln Krefeld et al.
DIREKT-LINK
Zu Adolph Bermbach, dem Mitglied der Paulskirchen-Versammlung. Kurze Biographie.
Der Prozess gegen das Mitglied der Nationalversammlung 1848/1849, Adolph Bermbach, am 9.1.1850 in Köln wegen Umsturz/Complott/Hochverrat etc.

DIREKT-LINK
ernst-faber-1895-china-in-historischer-beleuchtung-komplett-als-online-text.htm
Ernst Faber, 1895, "China in
historischer Beleuchtung" ||| komplett
als offener Online-Text
DIREKT-LINK
ernst-faber-1895-china-in-historischer-beleuchtung-komplett-als-online-text.htm
UND EINE KLEINE BIBLIOGRAFIE ZU ERNST FABER IST HIER:
DIREKT-LINK
buecher-und-publikationen-von-ernst-faber.htm

ALS
(zudem mahnende) QUELLE: Das Schriftleitergesetz der Nationalsozialisten von 1933 im
kompletten Originaltext (Wortlaut)

Wolfgang Müller von Königswinter STARTSEITE alle Müller-Pages bei klausjans.de
von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter
TABELLARISCHE
BIOGRAFIE
Zeitleiste
von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter, TEIL 1
W. M. v.
K.
TABELLARISCHE
BIOGRAFIE
Zeitleiste
von/zu
Wolfgang Müller von Königswinter, TEIL 2.
Liste der Bücher | Publikationen | Veröffentlichungen (Bibliografie) zu/für/von Wolfgang Müller von Königswinter.
Bislang bekannte Briefe an
und von Wolfgang Müller von
Königswinter
Komponistinnen/en-Liste
zu
"Junge
Lieder"
Ein paar T e x t e
von Wolfgang Müller von
Königswinter
Alphabetische
Titelliste der Gedichte Texte Buchtitel
et al. Wolfgang
Müller von Königswinter
Einige Personen
zu und um Wolfgang Müller von
Königswinter
RHEINWEINLIED Vergleich Version MATTHIAS CLAUDIUS und Neo-Version WOLFGANG MÜLLER VON KÖNIGSWINTER
IMPRESSUM
||| DATENSCHUTZERKLÄRUNG
||| Sitemap
||| HOME


 __|
|_ __| |_ __|
__|
|_ __| |_ __|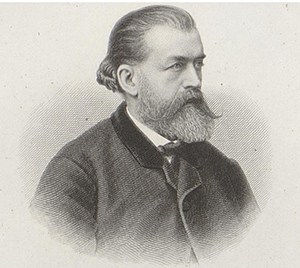

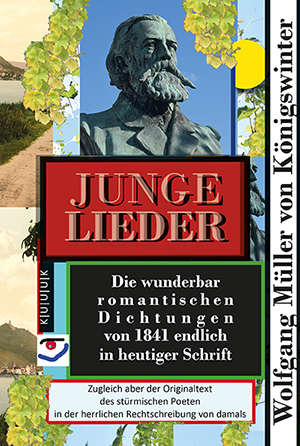
 am 15. Oktober 1821 Wilhelmine Stein (* 7.
3.1800 in
Köln | + 25.12.1865 Köln), die Tochter des Johann Heinrich
Stein, Begründer des (dann allerdings erst später dazu
gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der Katharina Maria Peill.
am 15. Oktober 1821 Wilhelmine Stein (* 7.
3.1800 in
Köln | + 25.12.1865 Köln), die Tochter des Johann Heinrich
Stein, Begründer des (dann allerdings erst später dazu
gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der Katharina Maria Peill.